unmodern talking's: From Coast to Coast
Burcu Doğramacı sprach am 12.11. im Rahmen der aktuellen Ausstellung The Futureless Memory im Kunsthaus zu „Riss der Zeit – Künste im Exil und die Vergangenheit der Zukunft“. Wie sich im Titel – eine Entlehnung des Titels der Autobiografie der Wiener Schauspielerin und Autorin Hertha Pauli – schon andeutet, begreift Doğramacı das Exil nicht nur als ein räumliches, sondern auch ein zeitliches Phänomen. Das Exil befindet sich außerhalb des zeitlichen Kontinuums, es diktiert eine neue Zeitrechnung, in der sich das Empfinden von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft mal unendlich dehnt, mal in einem einzigen Moment verdichtet. Dieser „Riss der Zeit“ geht aber auch durch die (Kunst-)Geschichtsschreibung selbst, die nach wie vor als nationale Erzählung geschrieben wird und sich bekanntermaßen sowieso mit Gleichzeitigkeiten, Anachronismen und Parallelgeschichten schwertut. Was im Exil geschah, was dort erlebt, geschaffen und verloren wurde; das wird auch weiterhin wenn dann nur an den Außenrändern der Geschichtsschreibung aufgezeichnet.
In ihrer Forschung bemüht sich Doğramacı um eine Repräsentation eben dieser Fehlstellen und verlorenen Geschichten und damit auch der Lückenhaftigkeit nationaler (Kunst-)Geschichtsschreibung. Sie vollzieht in ihrem Vortrag die zentrifugale Dynamik der erzwungenen Emigration während der Zeit des Nationalsozialismus nach und fragt: Wer war wo zur selben Zeit? Am Schlüsseljahr 1938 entfaltet sie so ein Kaleidoskop der Gleichzeitigkeit in unterschiedlichsten Zeitzonen. 1938 lehrt und baut der Architekt Bruno Taut in Istanbul, 1938 bemüht sich der Bildhauer Jussuf Abbo um Portraitaufträge in London, 1938 versucht die Bauhauslehrerin und Textilkünstlerin Otti Berger vergeblich in London Fuß zu fassen, 1938 findet der Bildhauer De Fiori in San Paolo zu einer neuen Form, 1938 fotografiert Lotte Jacobi den ebenfalls exilierten Albert Einstein in seiner ikonischen Lederjacke in New York City, 1938 hält Edmund Engelmann den exakten Zustand des Wiener Büros Sigmund Freuds akribisch auf Fotografien fest, um seine spätere Rekonstruktion in London zu ermöglichen.
Es sind Geschichten von Unsichtbarkeit, Einsamkeit, Übersetzungsschwierigkeiten, Kompromissen, Verlusten, aber auch solche von neuen Allianzen und Communitys, komplexen Identitätskonstruktionen und Werkbegriffen. Je nach eigener Voraussetzungen – Gender, Profession, Netzwerk, Kapital, Professionalisierung – gestaltet sich der erzwungene Neuanfang mal einfacher, mal beschwerlicher bis unmöglich. All diese Biografien eint jedoch, dass sie durch die weltweite Versprengung aus dem Kontinuum der nationalen Kunstgeschichtsschreibung hinaus katapultiert wurden und aus der kollektiven Erinnerung gelöscht wurden. Diese Auslöschung schlägt sich nicht nur in ihrem zeitgenössischen Regime wieder – manifestiert durch Bücherverbrennungen, die Ausstellung „entartete Kunst“ oder Berufsverbote – sondern auch in der nachfolgenden Kartierung der Moderne. Eben jener Moderne unterstellt Burcu Doğramacı eine jahrzehntelange Amnesie, die ihre Beweise in vergessenen Oeuvres und bis heute ausstehenden institutionellen Rehabilitierung vieler exilierter Künstler:innen findet. Doğramacı plädiert daher nachdrücklich dafür – und lebt es in ihrer eigenen Forschungsarbeit vor – nicht länger in nationalen Beschreibungen zu verharren. Um die Geschichten jener, die gewaltvoll aus den Epizentren der Moderne verdrängt wurden, zu rekonstruieren, gilt es Fakten und Erzählungen zusammenzutragen und dabei auch die Autobiografien der Künstler:innen, so streitbar sie als Quelle auch sein mögen, ernst zunehmen. Selbstbeschreibungen aus dem Exil geben nicht nur Zeugnis ab über die Gründe und Umstände ihrer Dislokation, sondern verorten die Autor:innen auch explizit im Umfeld der Exilant:innen.
Doğramacı schlägt in ihrem Vortrag eine Herangehensweise an (Kunst-)Geschichtsschreibung vor, die nicht eine bestimmte Organisationseinheit – beispielsweise „die Nation“ – als die Absolute setzt. Im Zentrum ihrer Ausführungen steht die Einsicht, dass Geschichtsschreibung grundsätzlich fragmentarisch, eklektisch und eben auch ungerecht ist. Um jene Positionen, die aufgrund einer bis heute fortgeschriebenen, national orientierten und monoperspektivischen (Kunst-)Geschichtsschreibung durch das Raster fielen, in die kollektive Erinnerung zurückzuholen sind Anstrengungen und Commitments seitens der Institutionen gefragt – wir sind gespannt, was möglich ist.
Der Vortrag wurde hier aufgezeichnet.
Text: Magdalena Grüner und Nina Lucia Groß







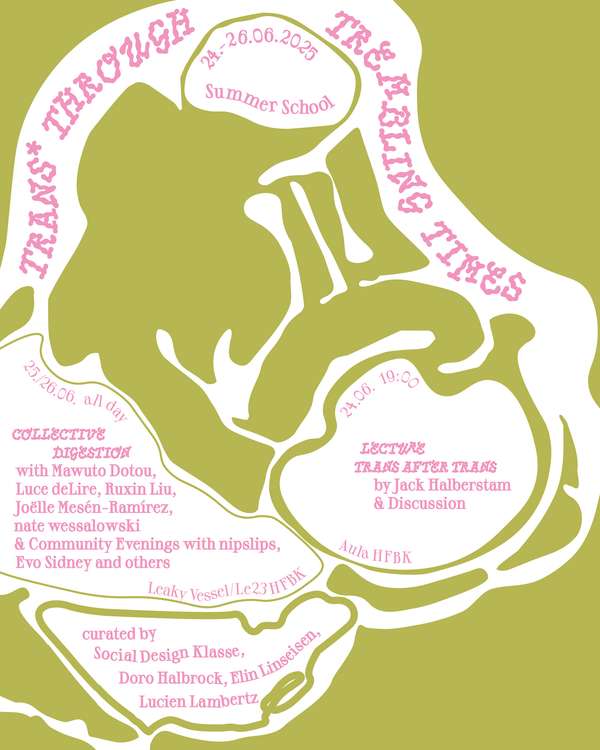





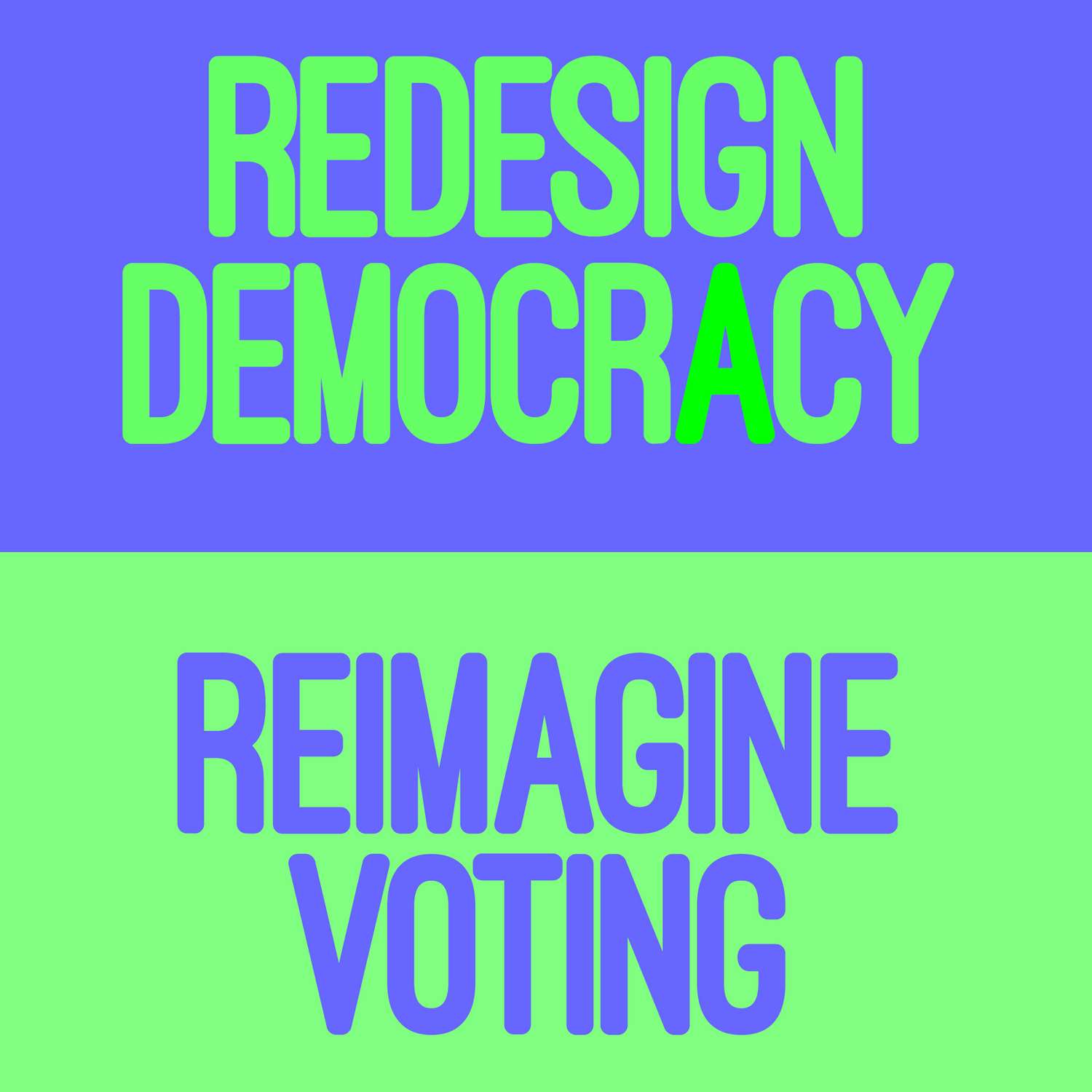











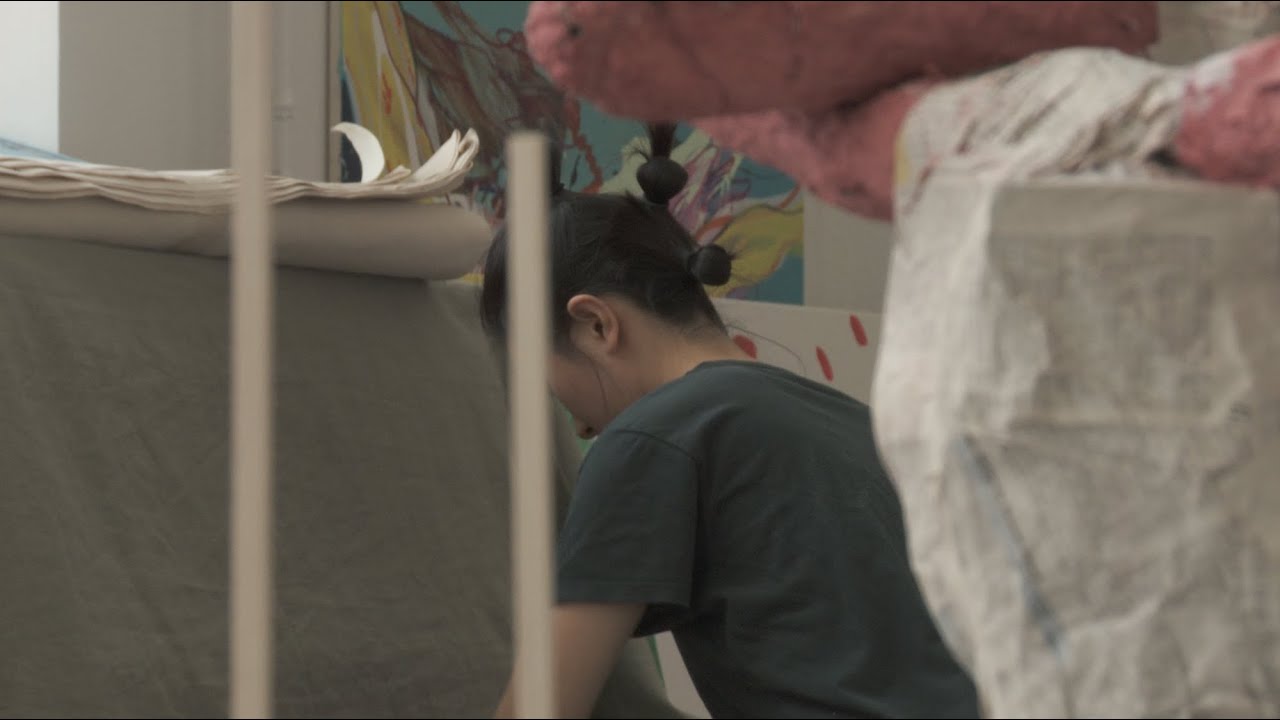






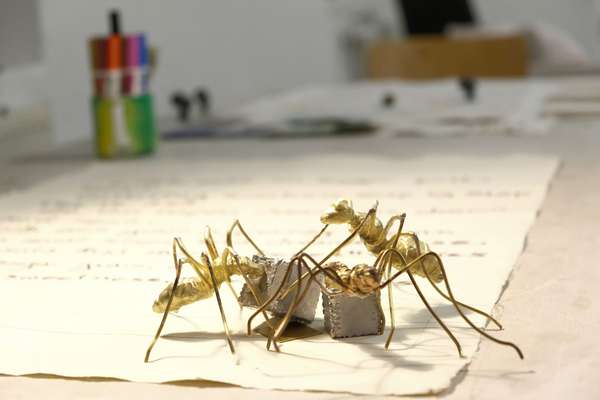




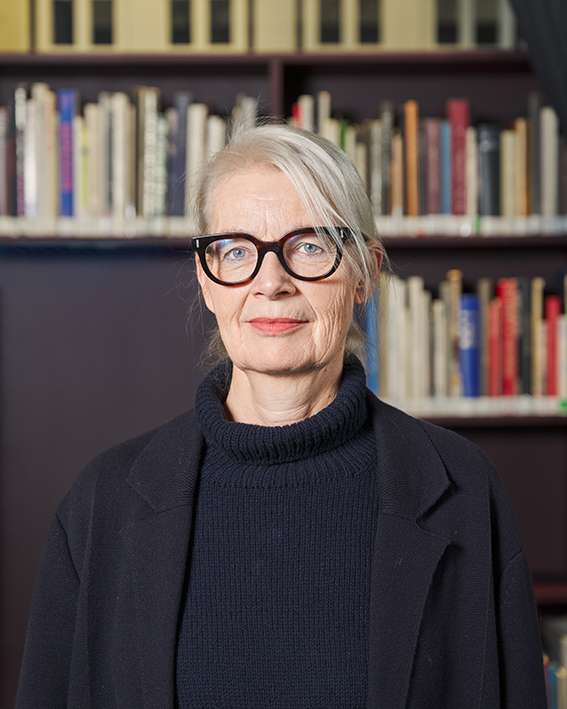














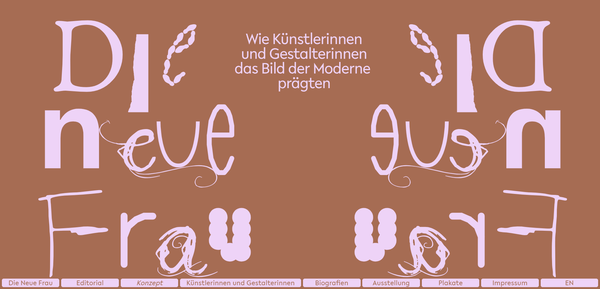




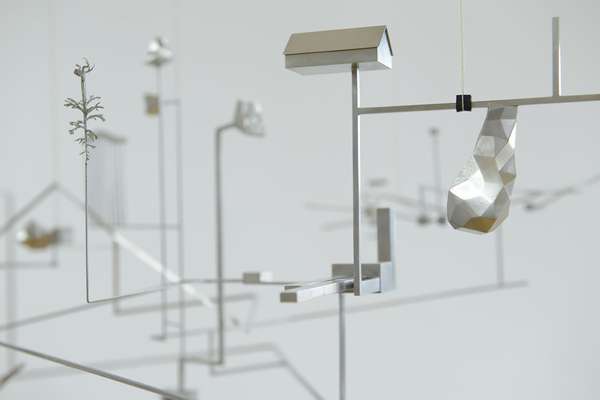











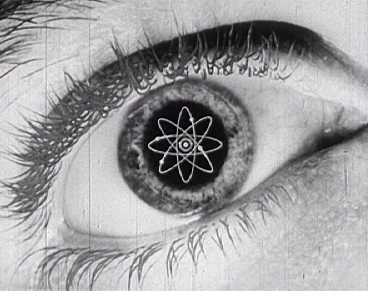
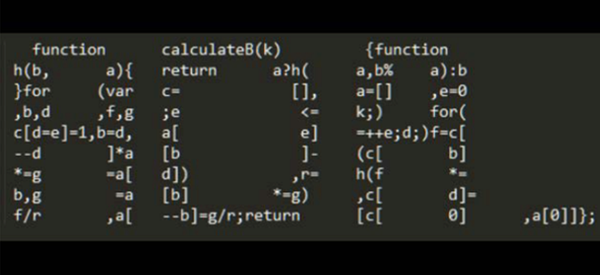
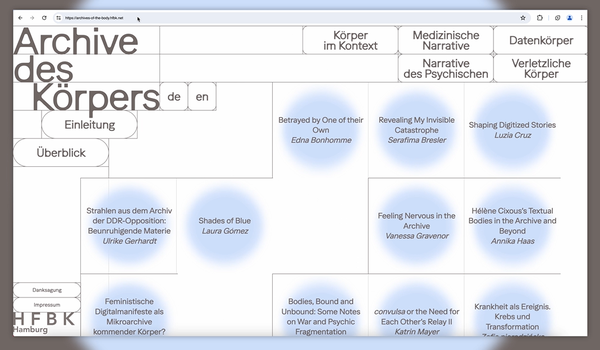
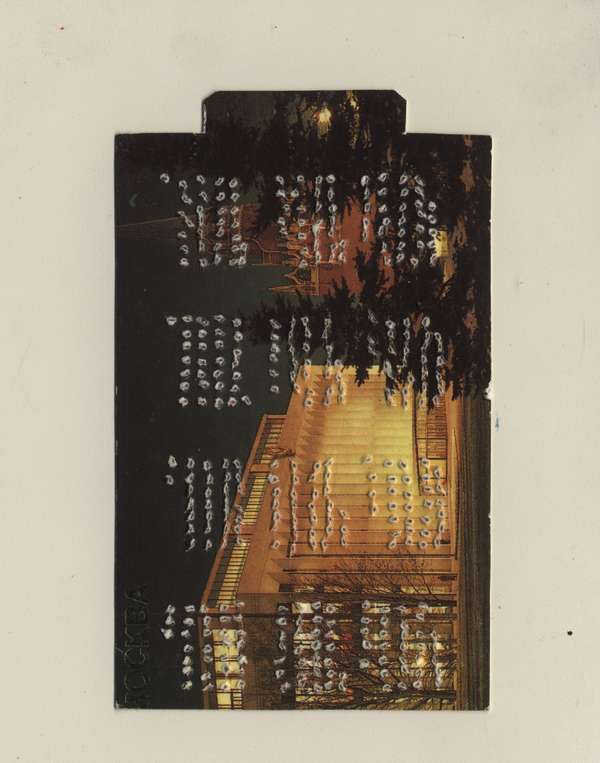
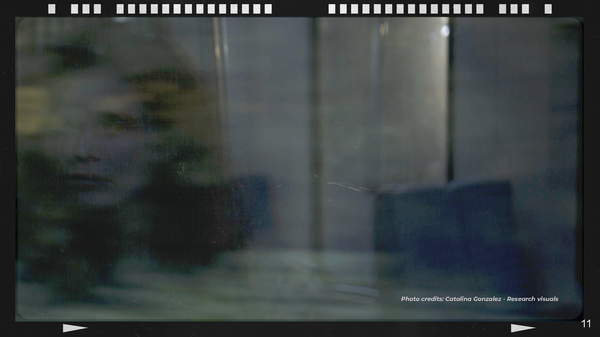



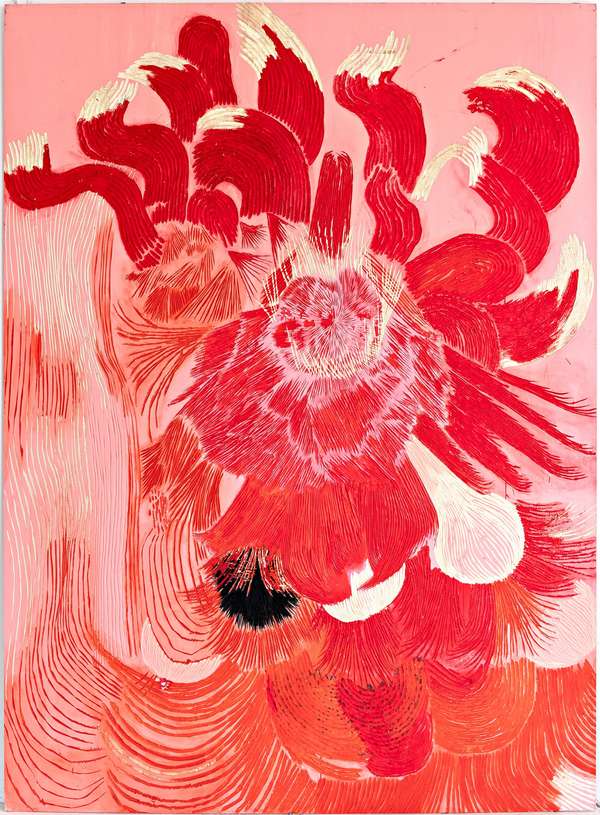







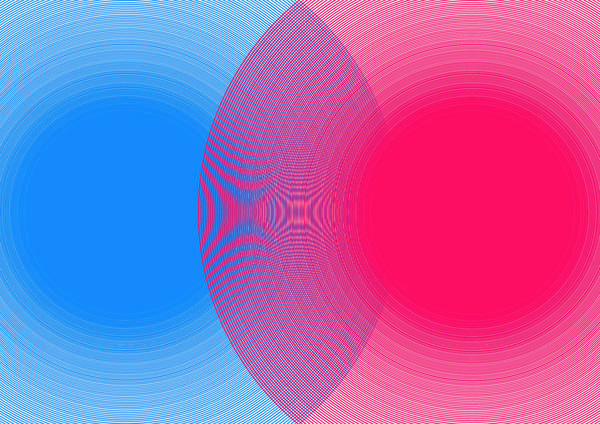






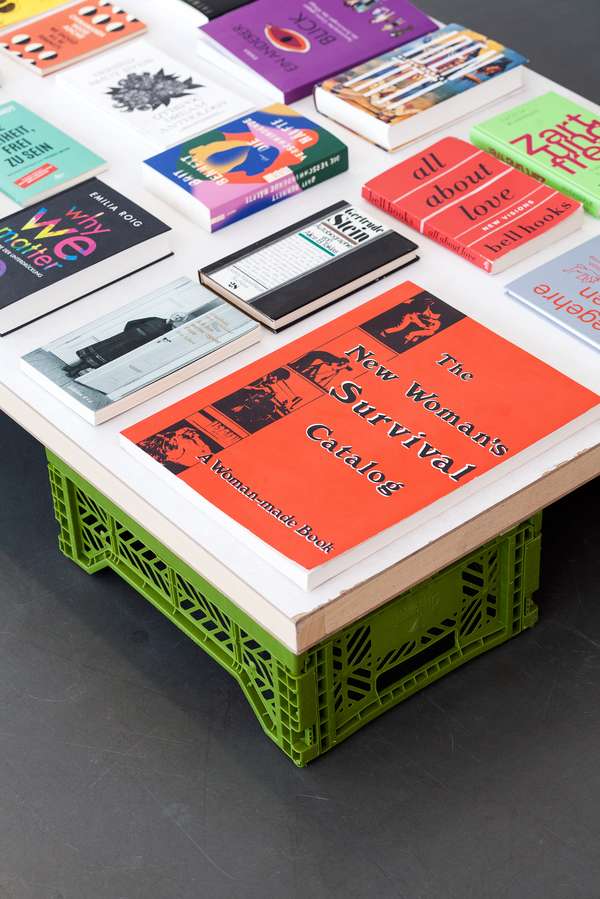



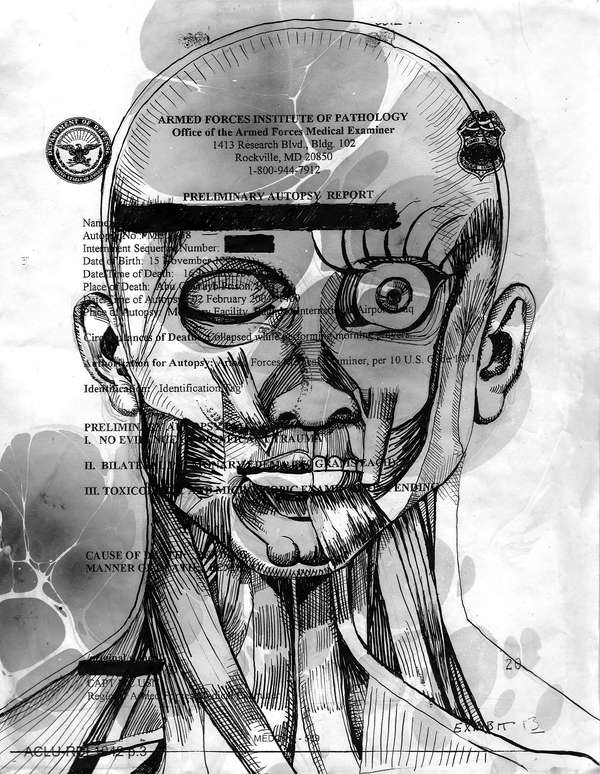

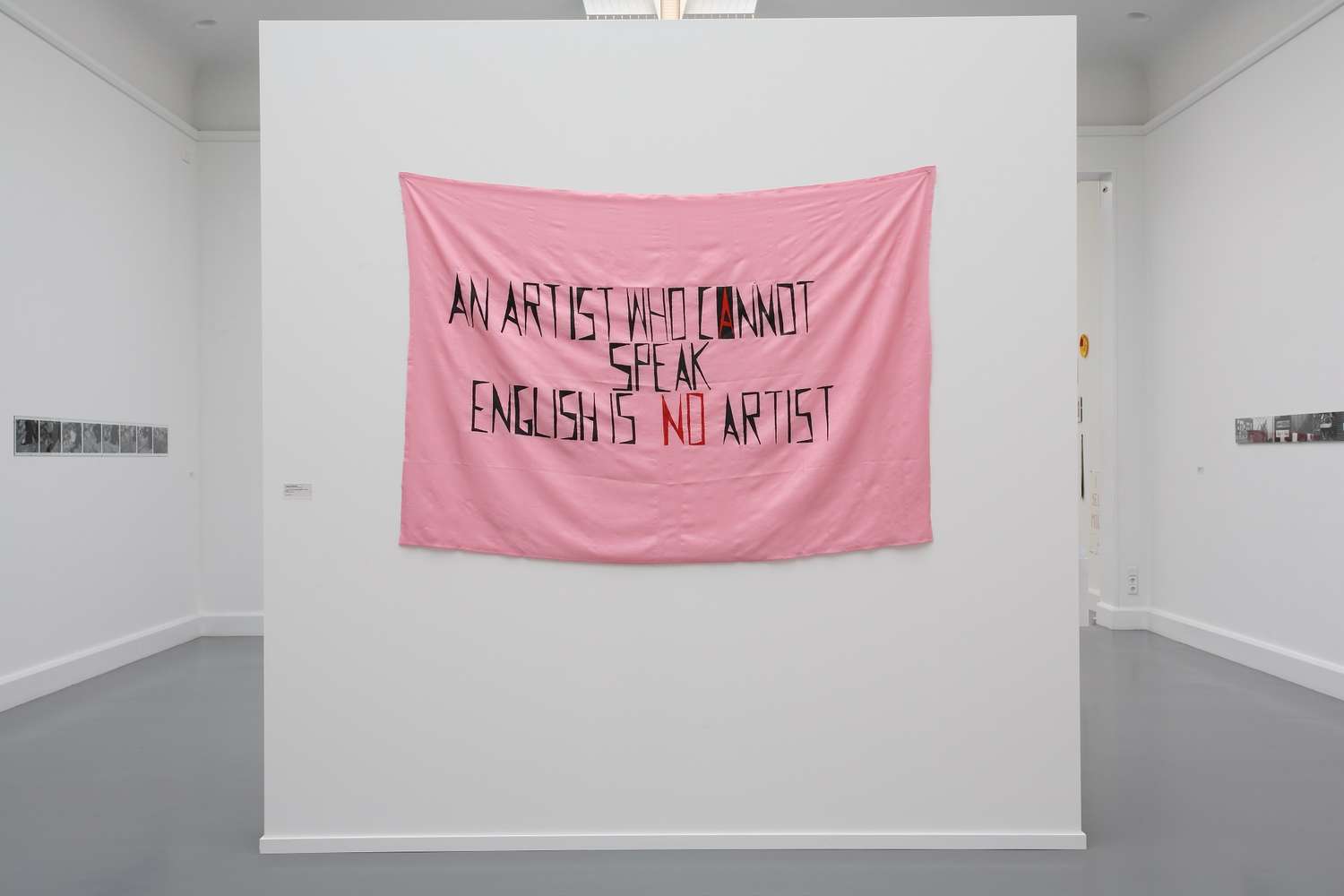

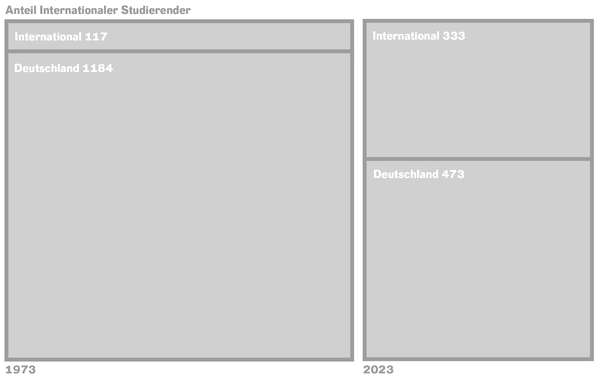
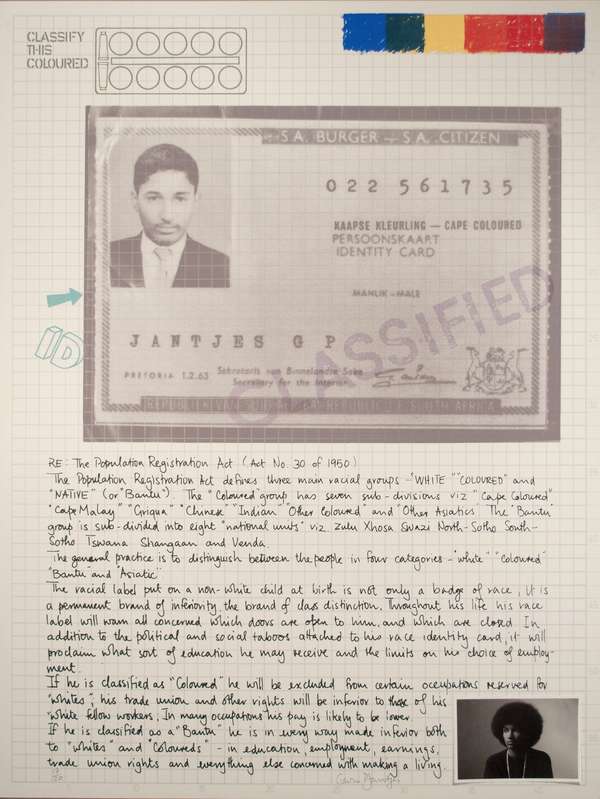
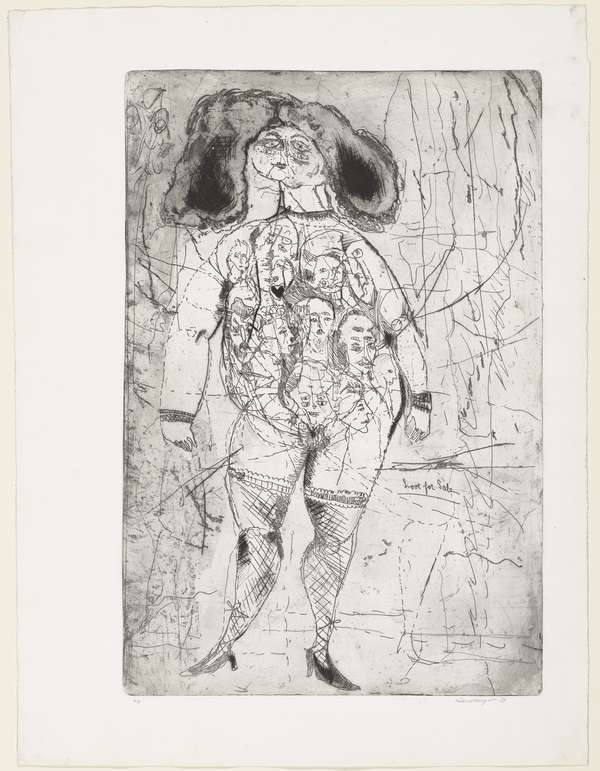
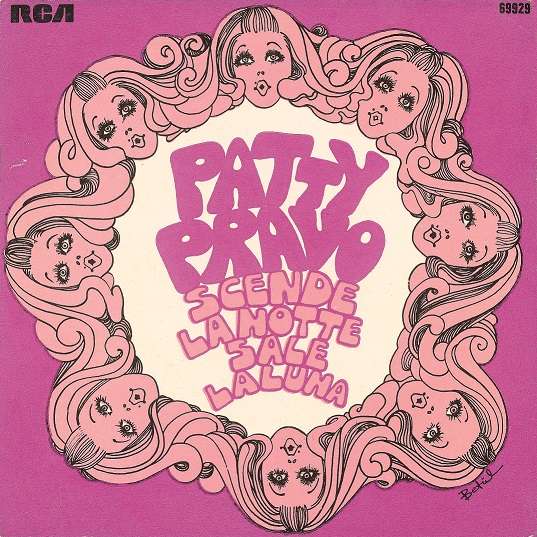





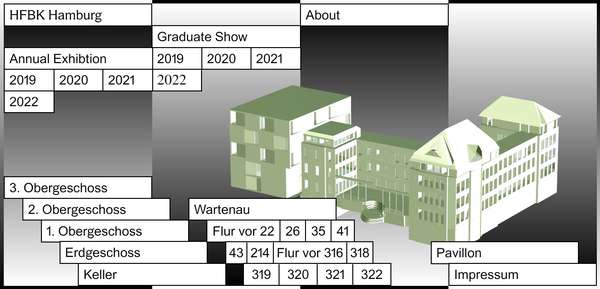
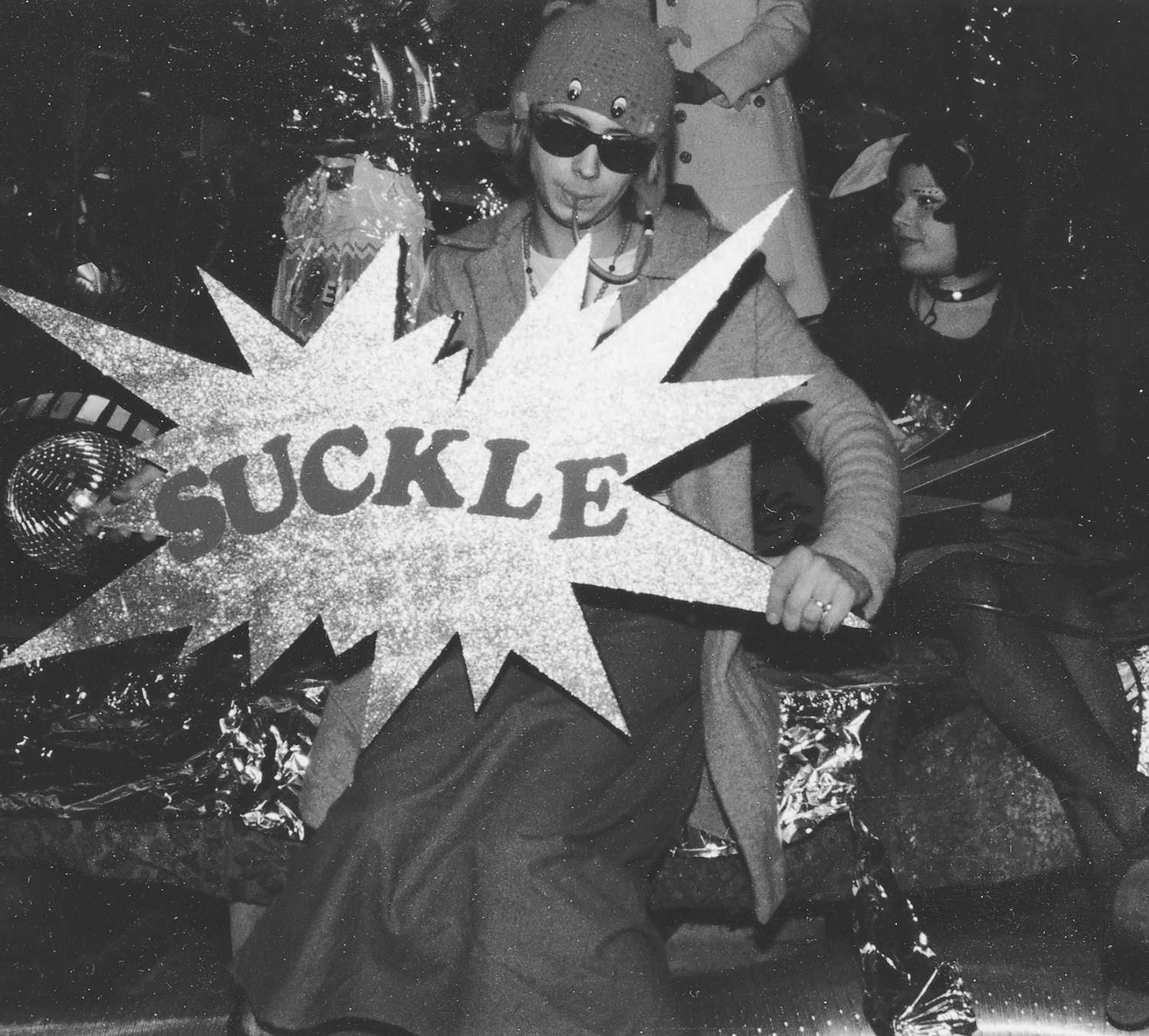



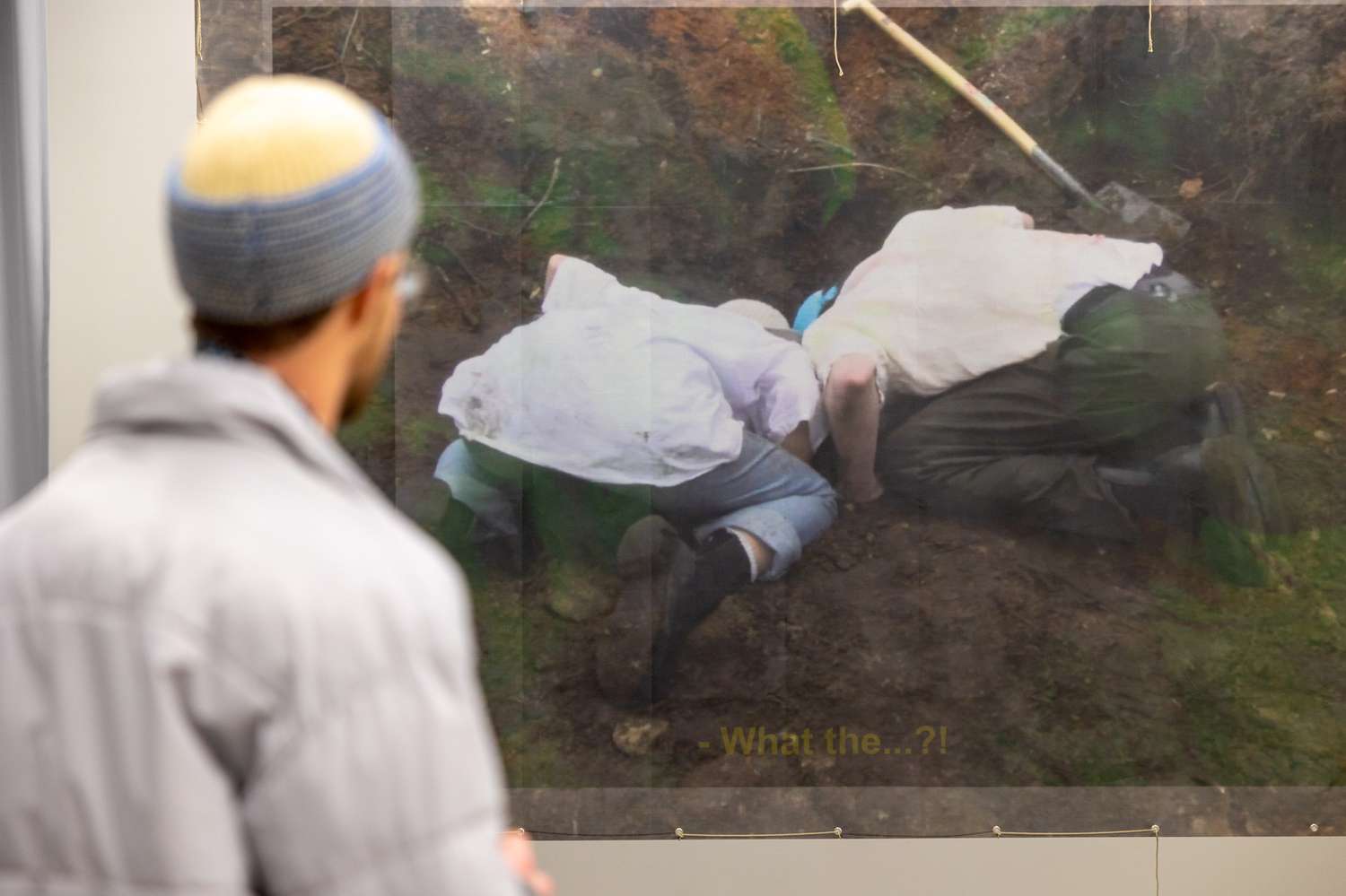


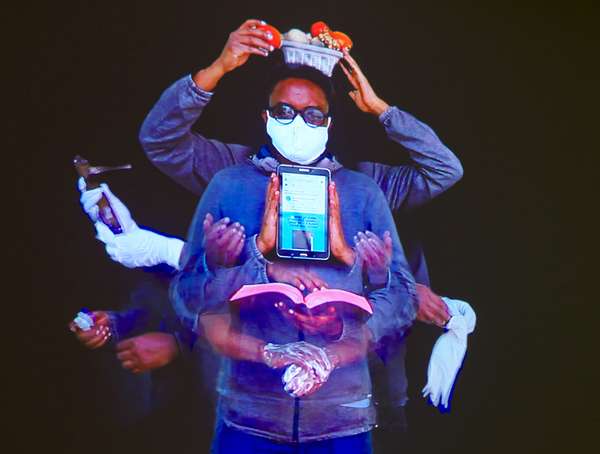
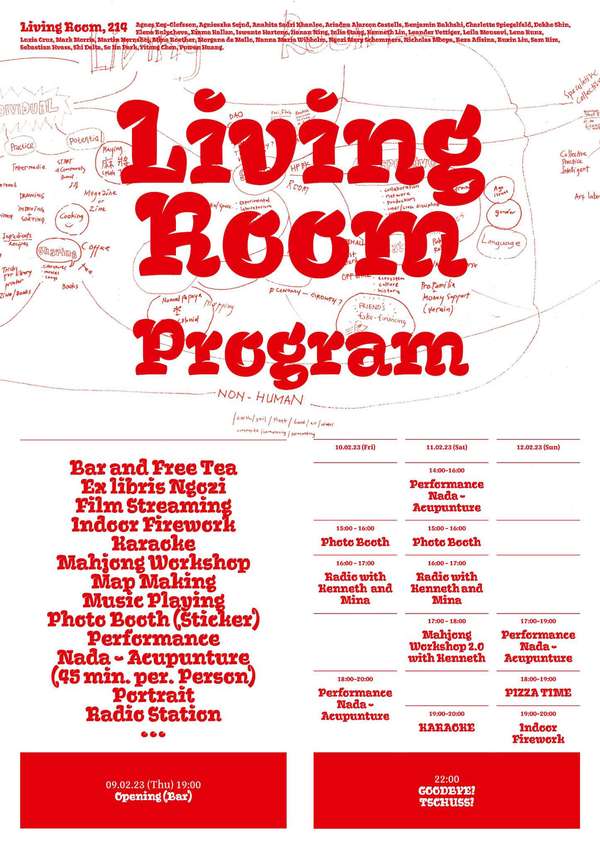
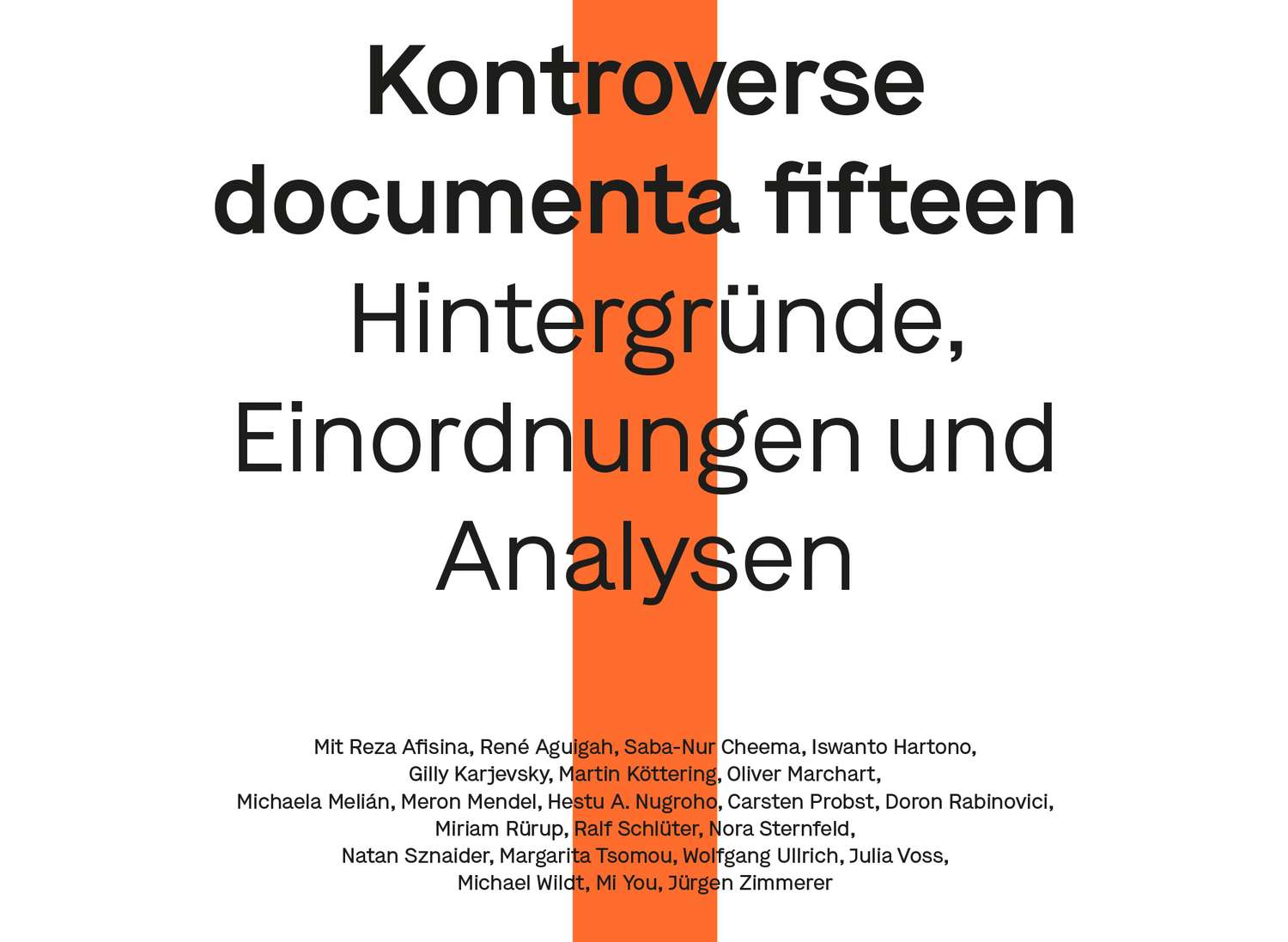




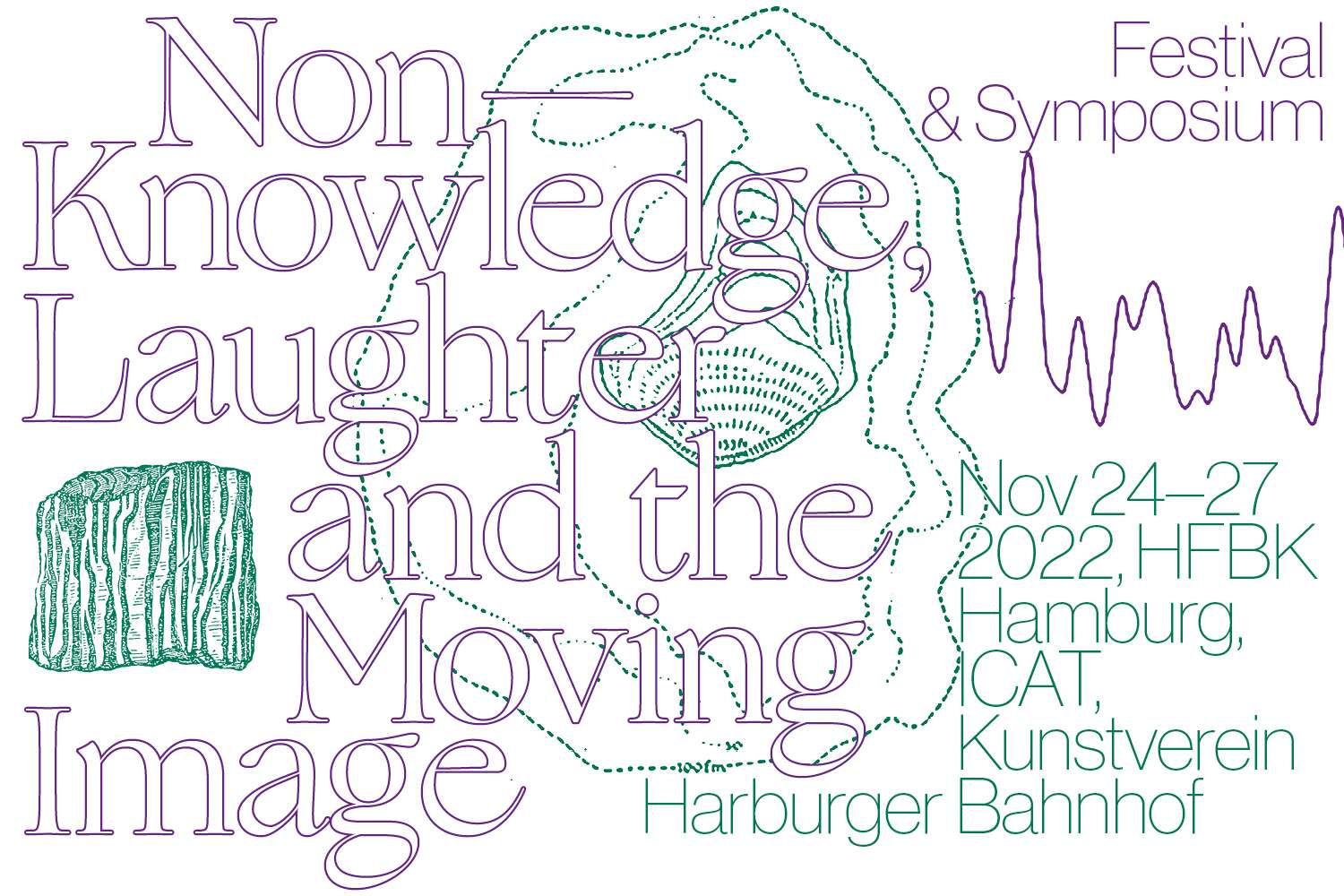









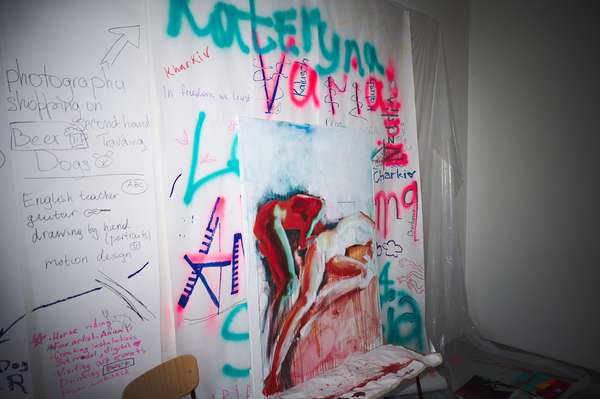




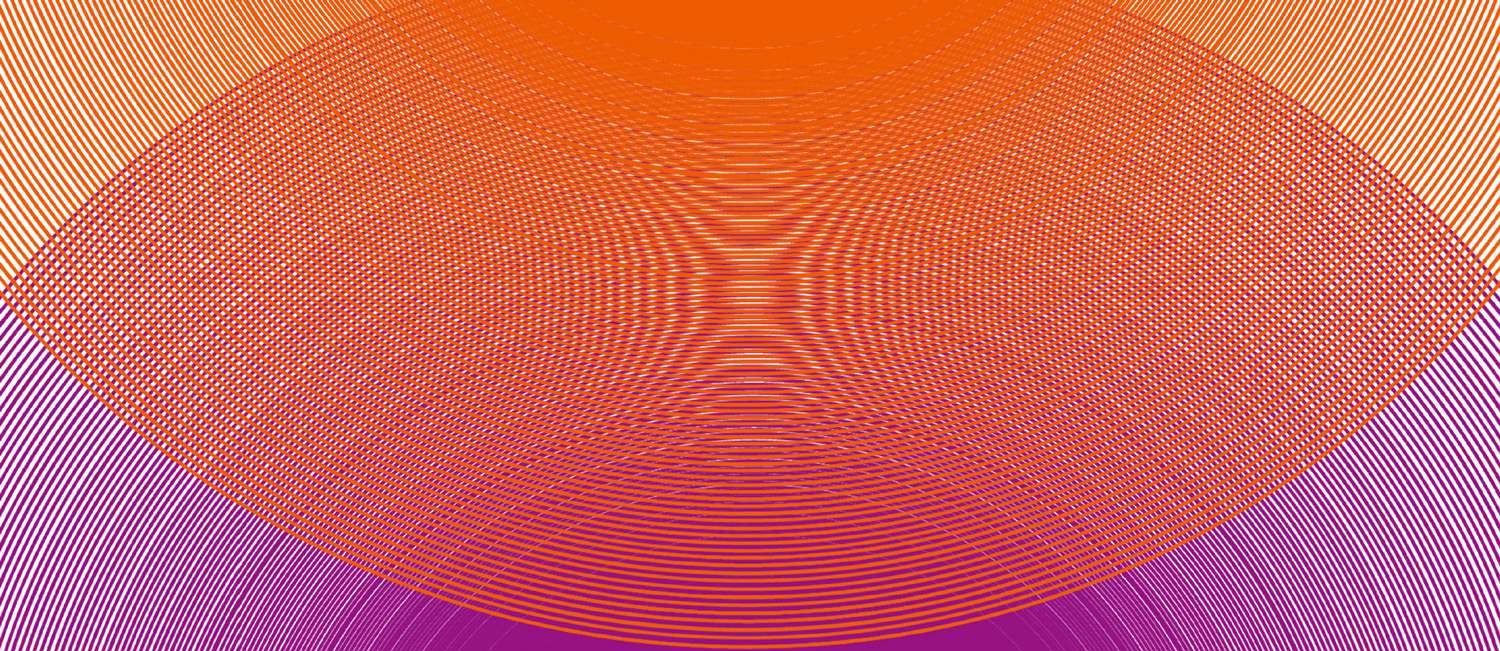
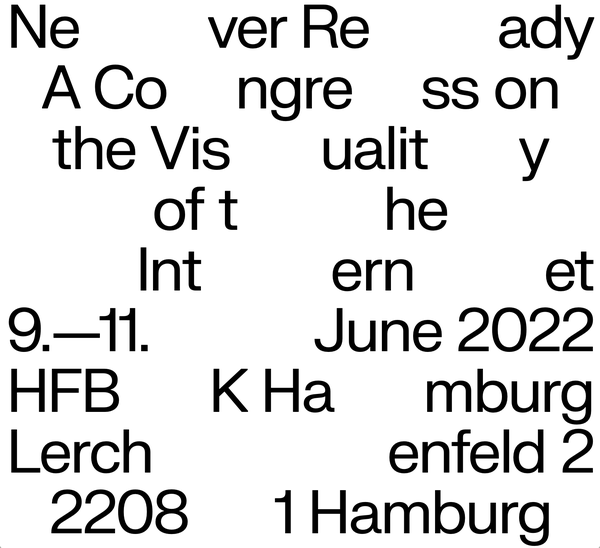


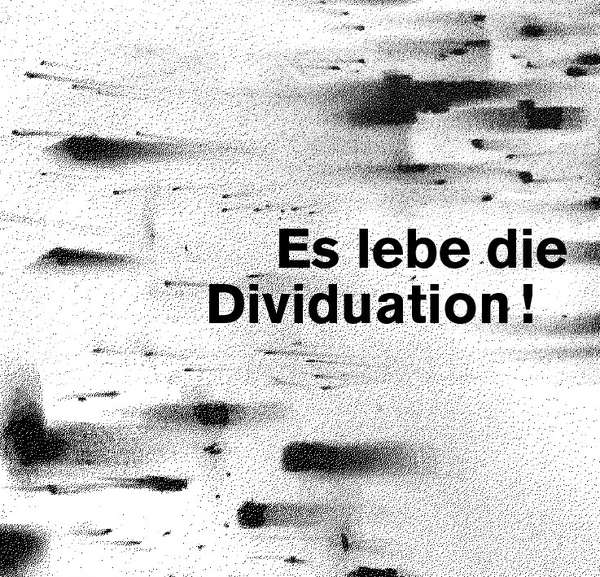
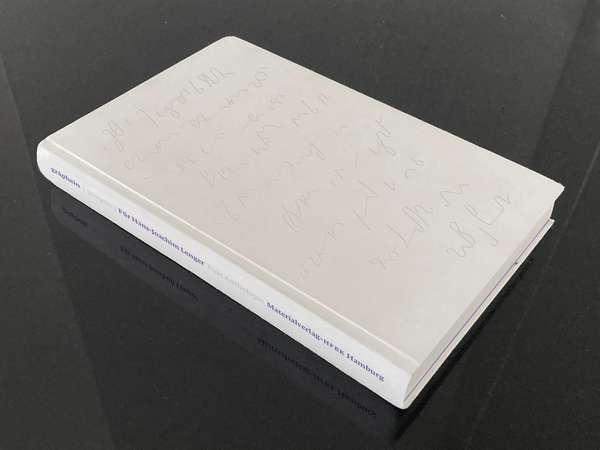
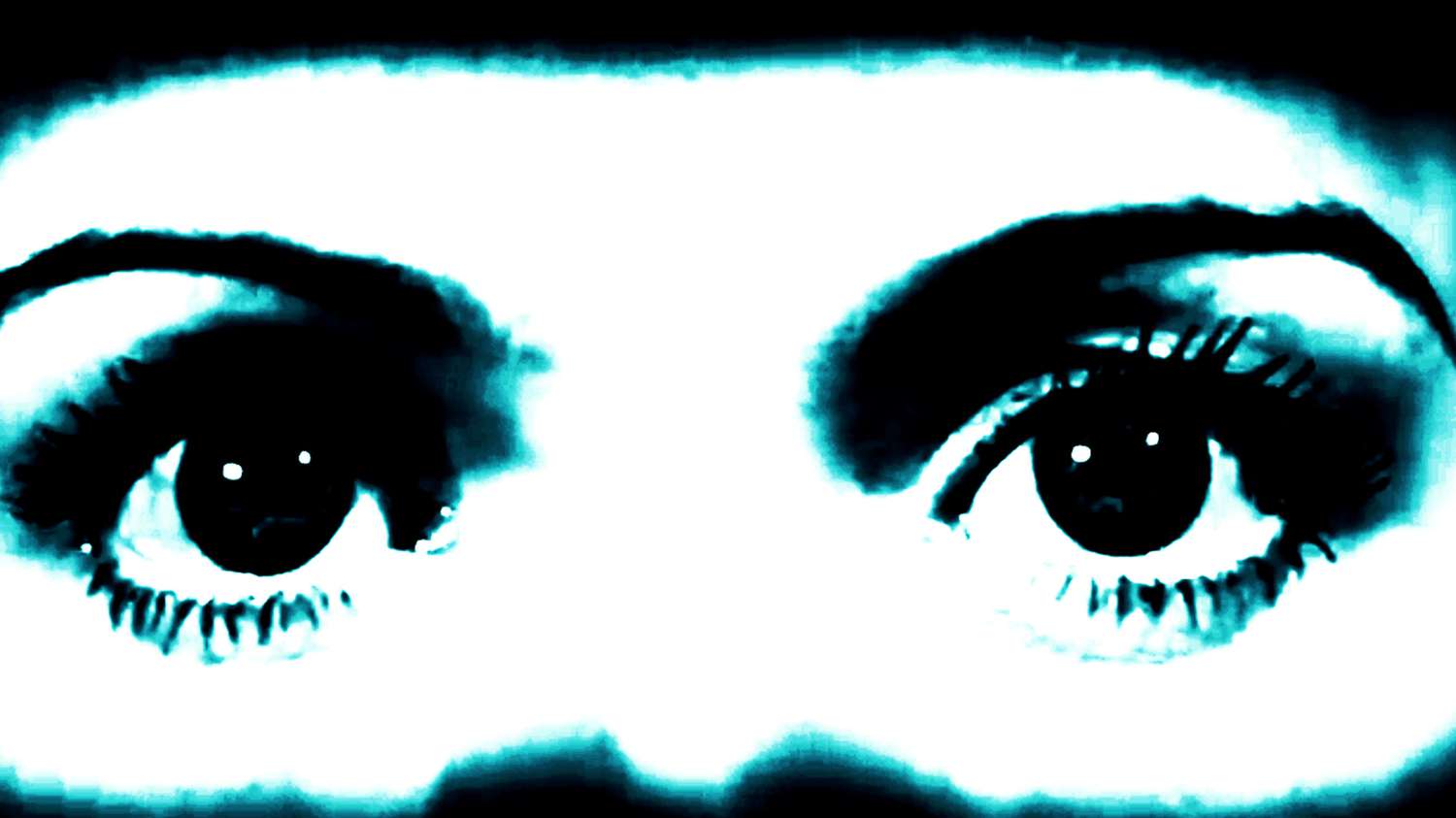
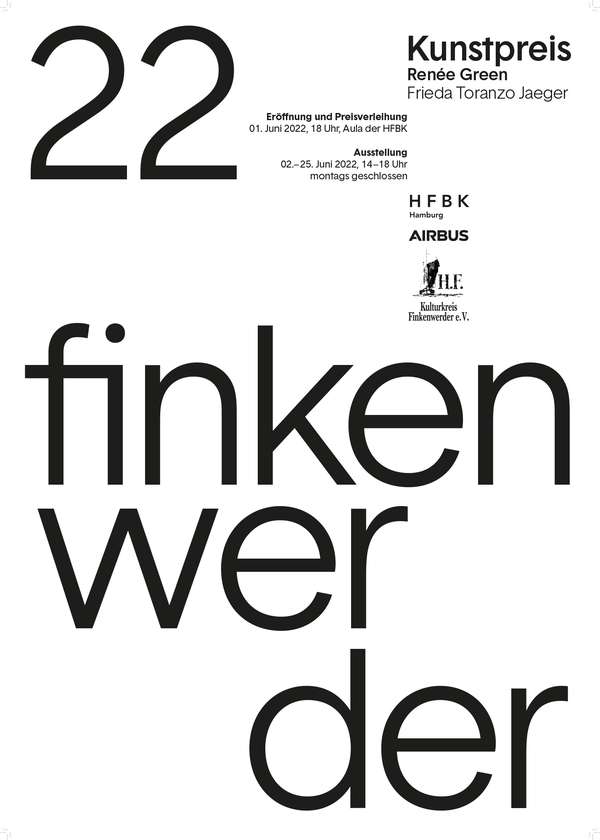















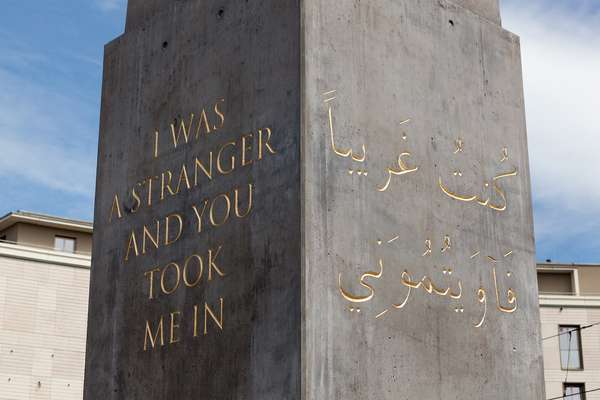
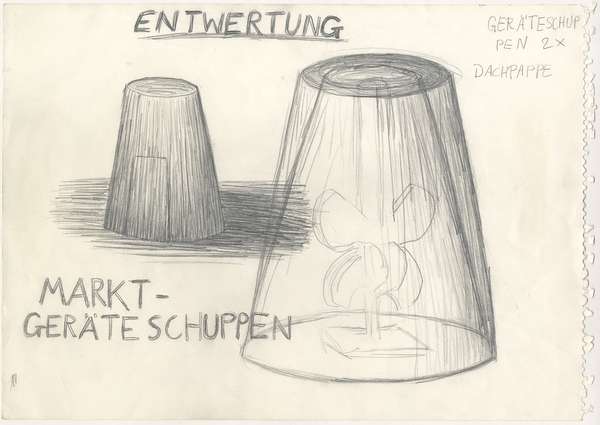
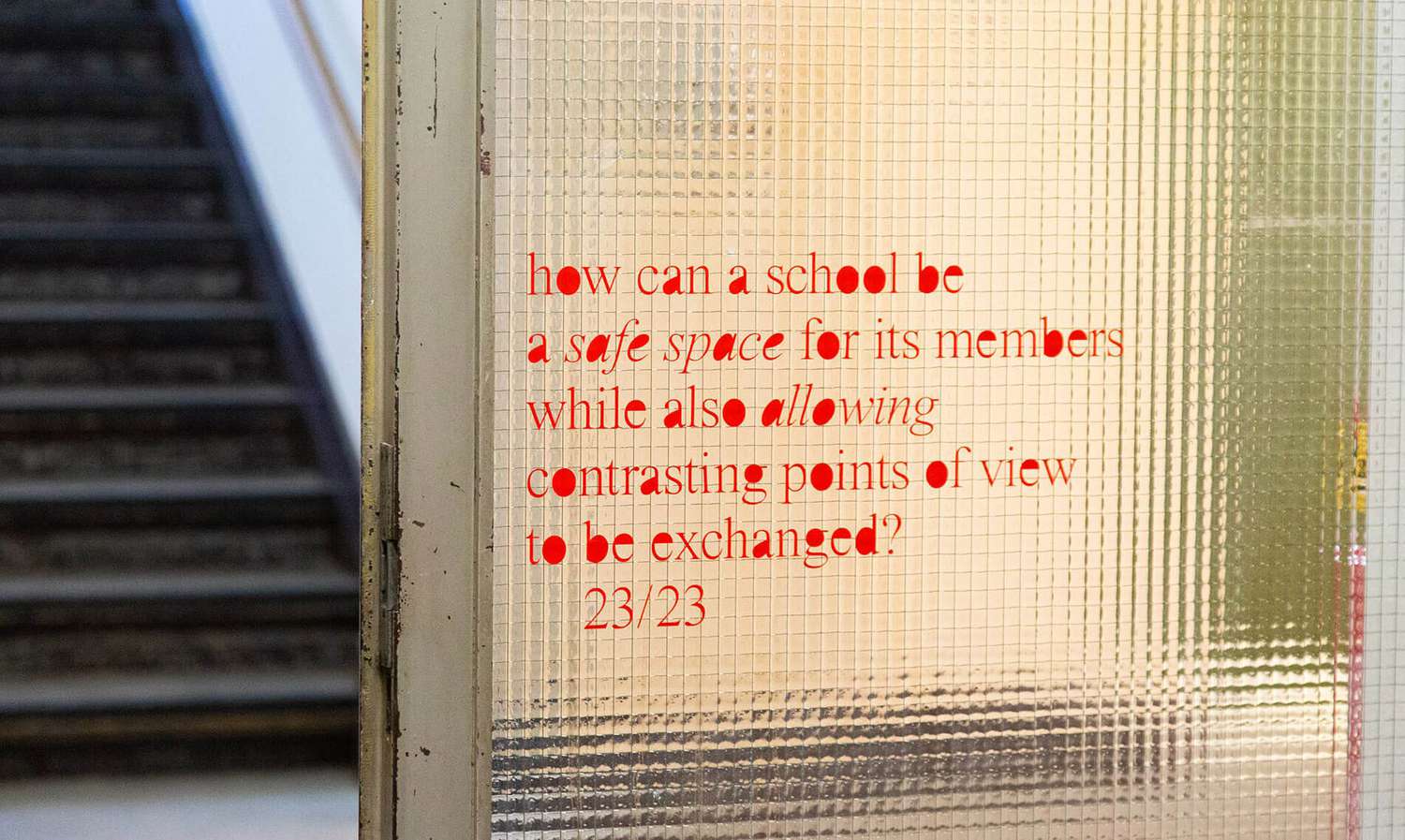

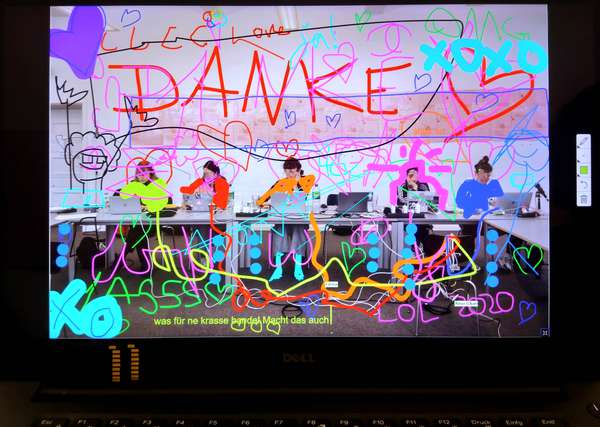
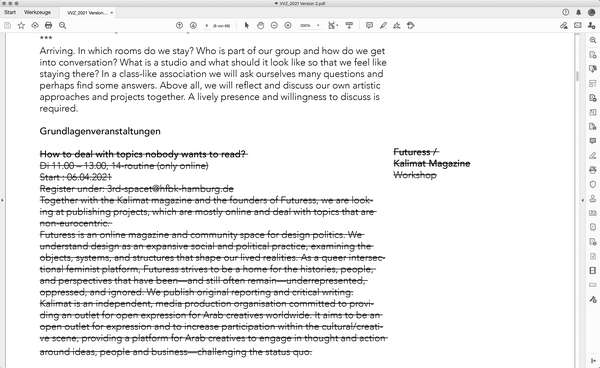
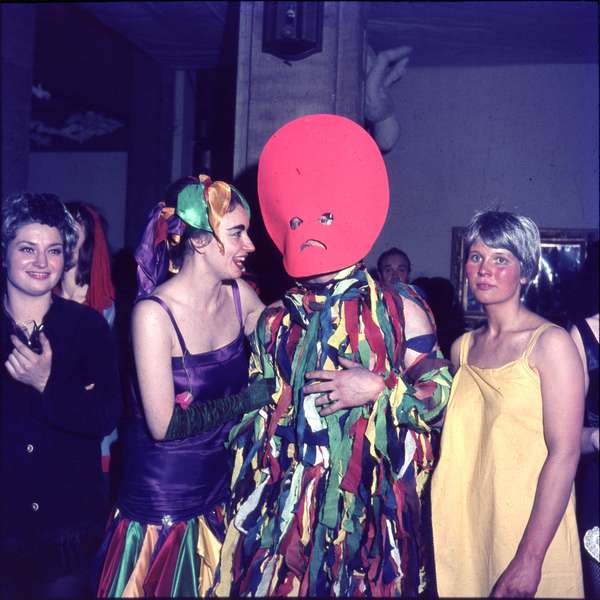





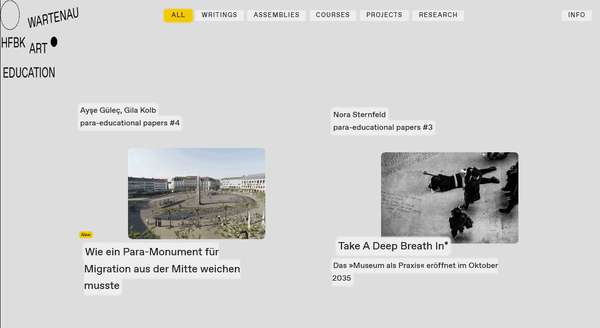

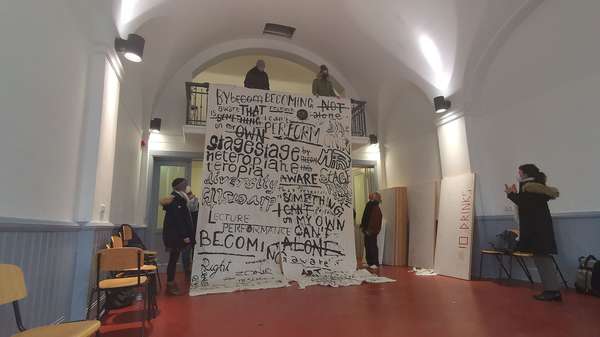
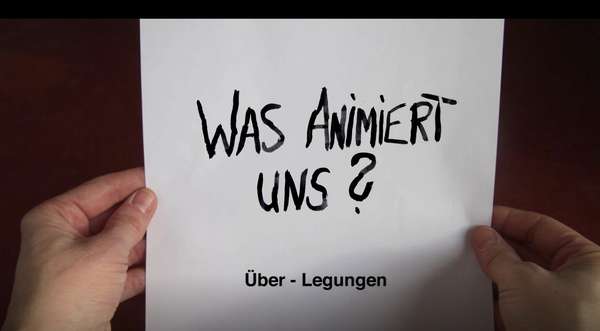





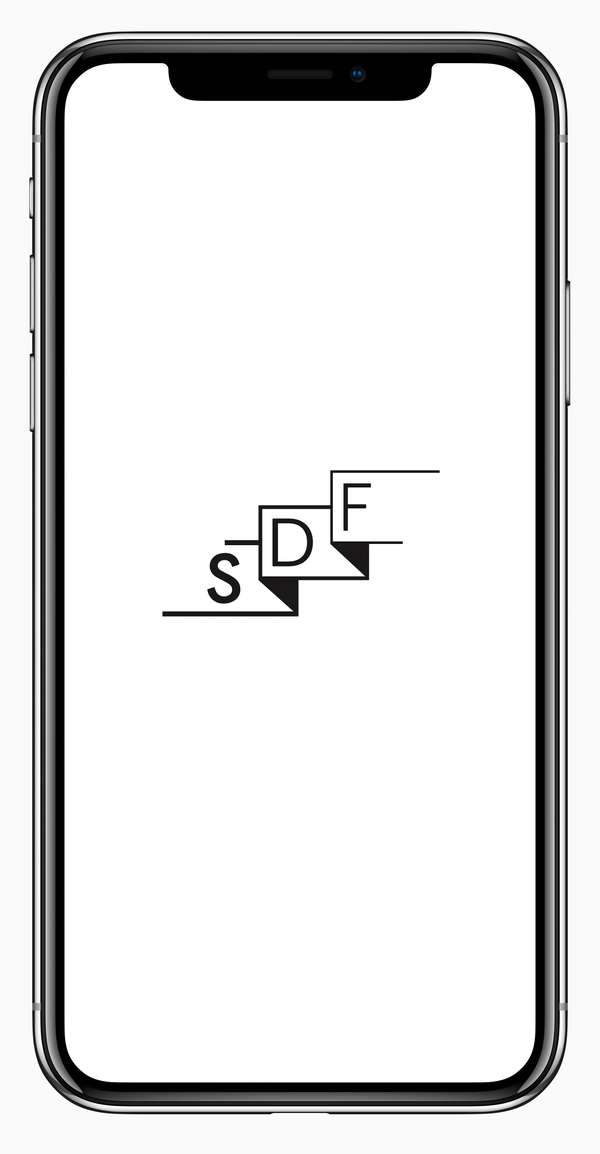
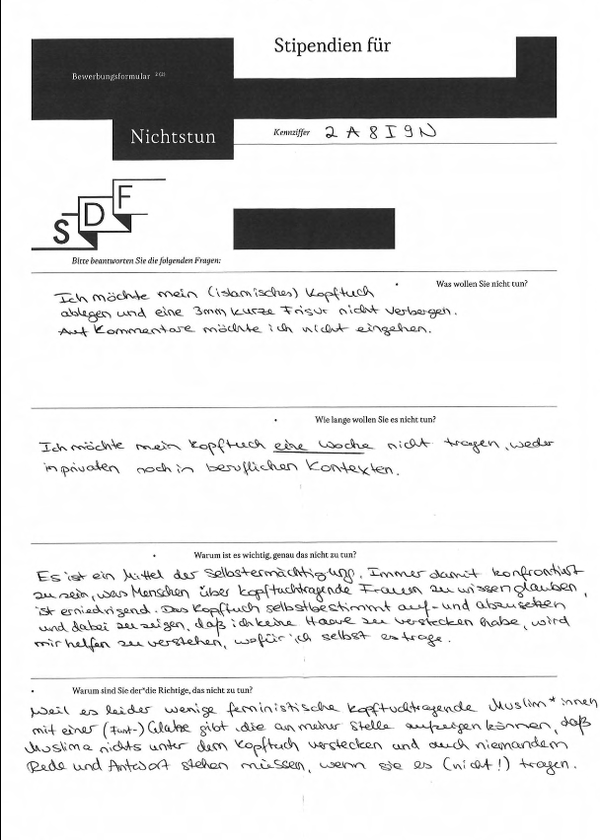


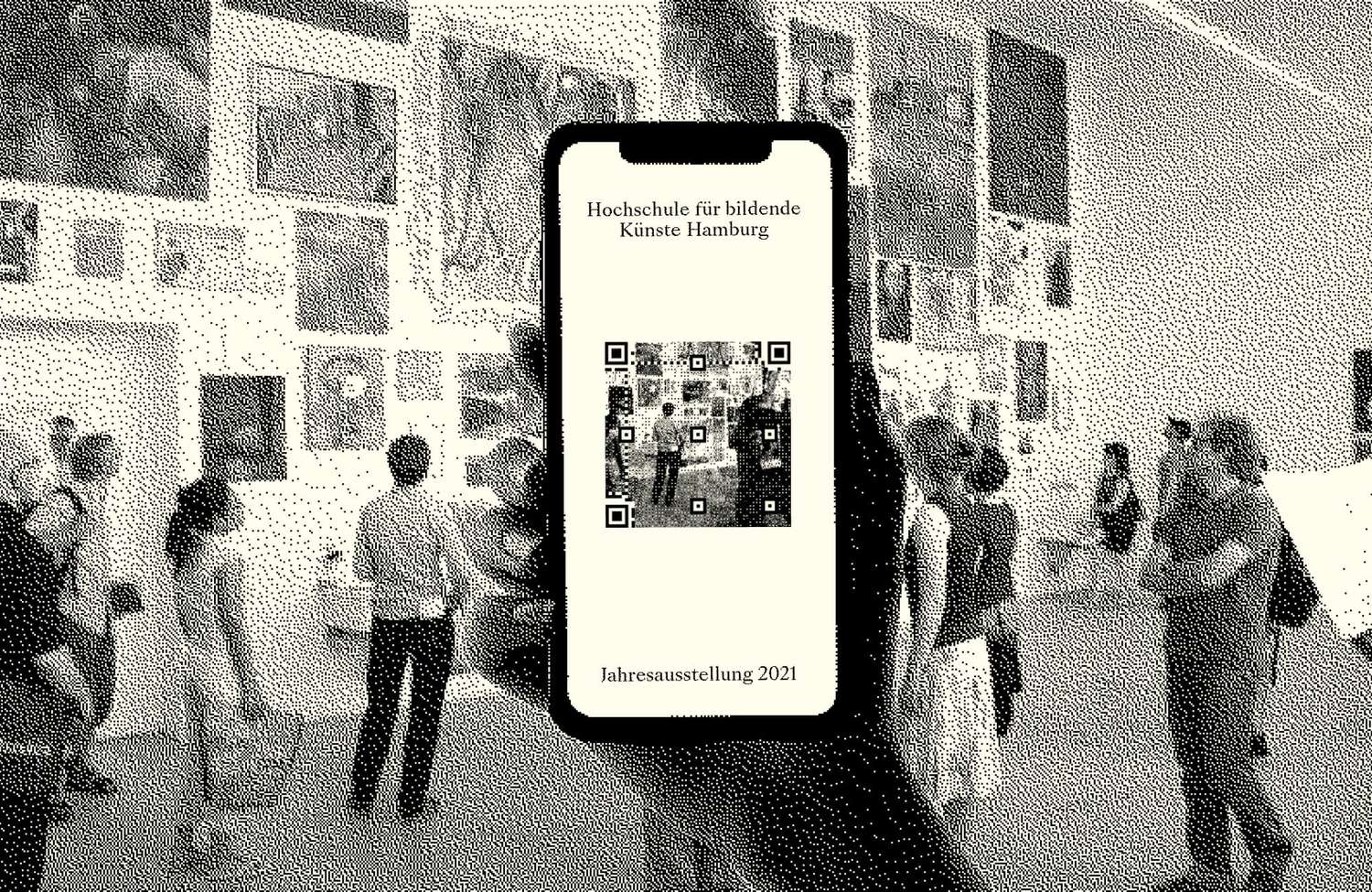

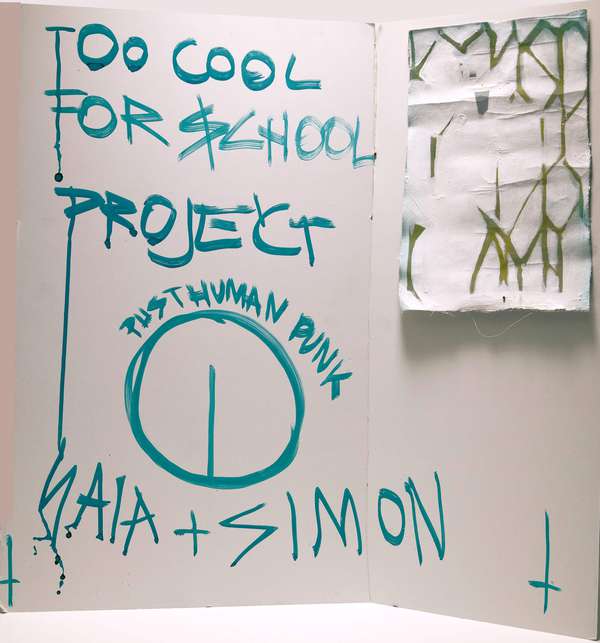

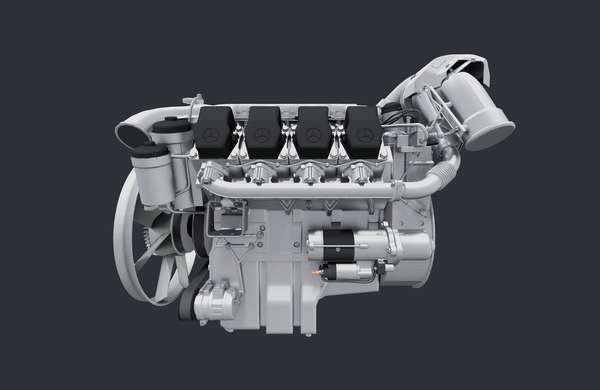





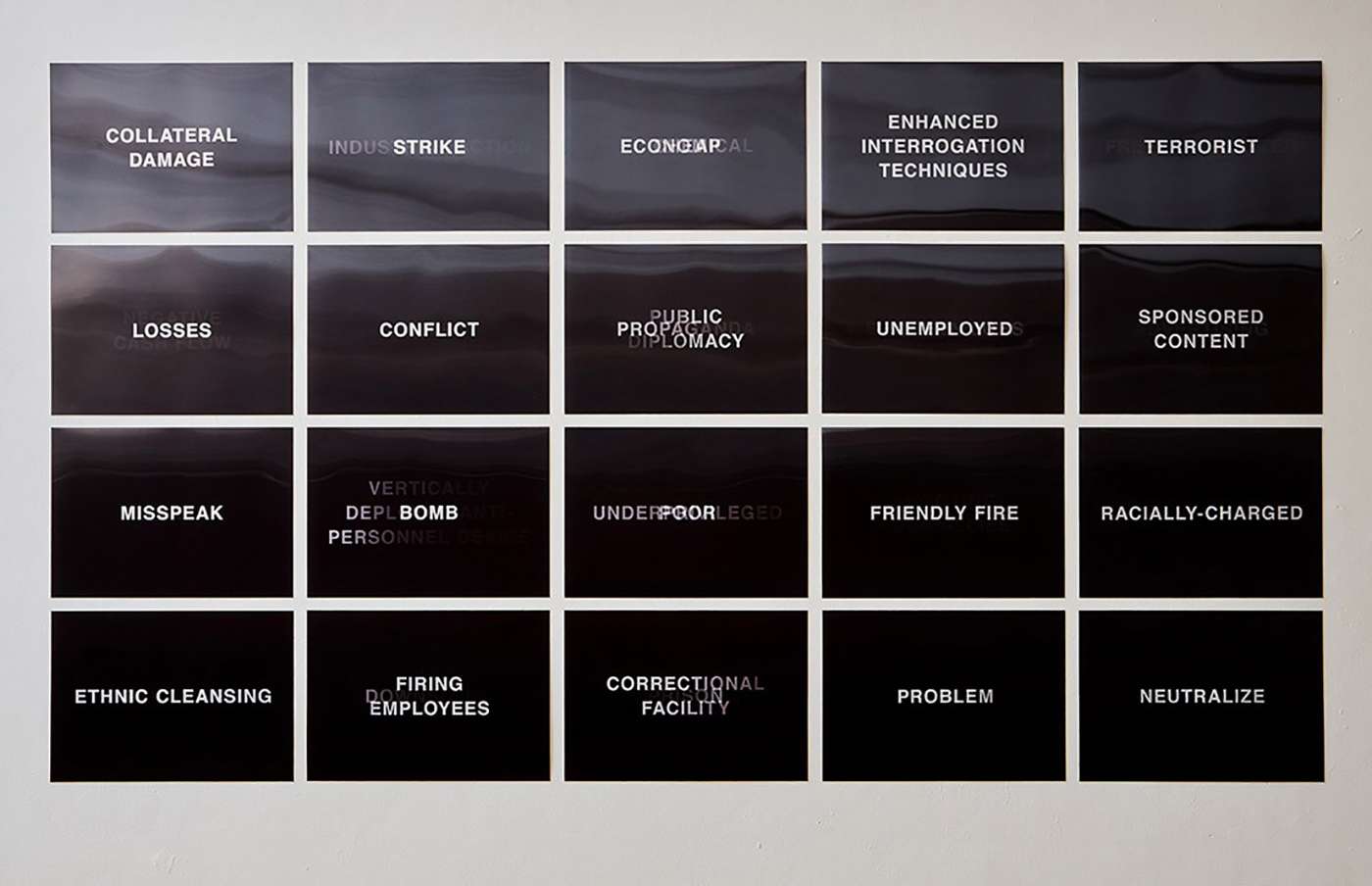




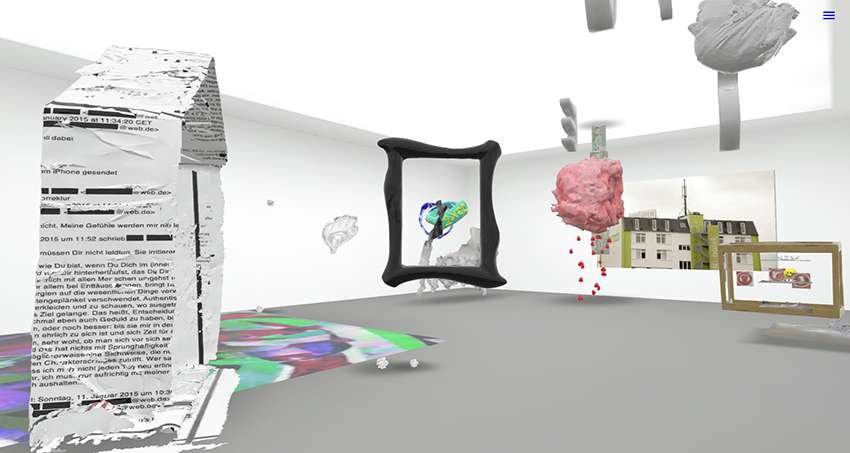
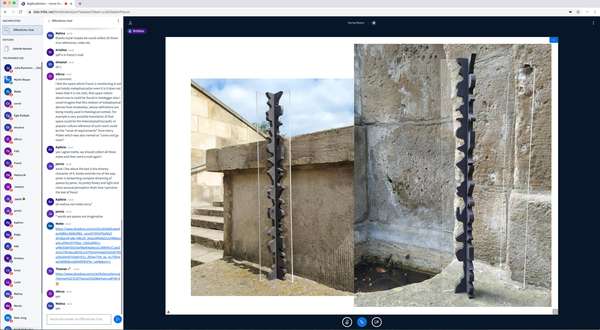
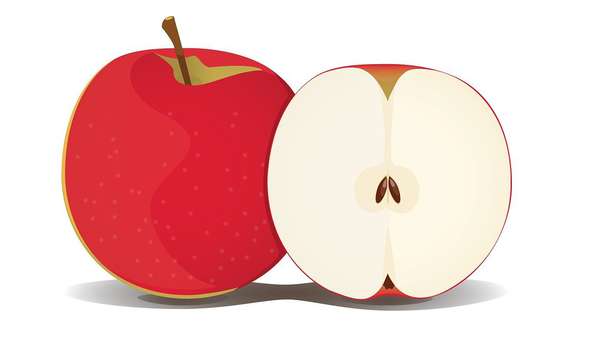

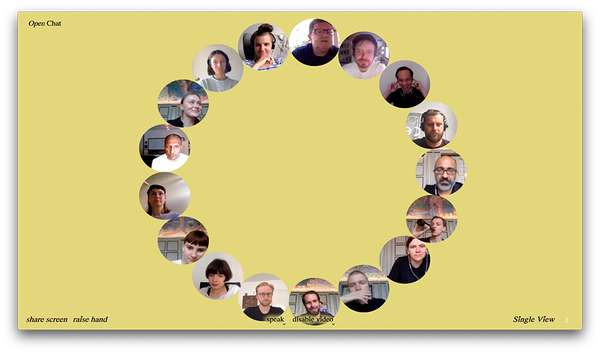
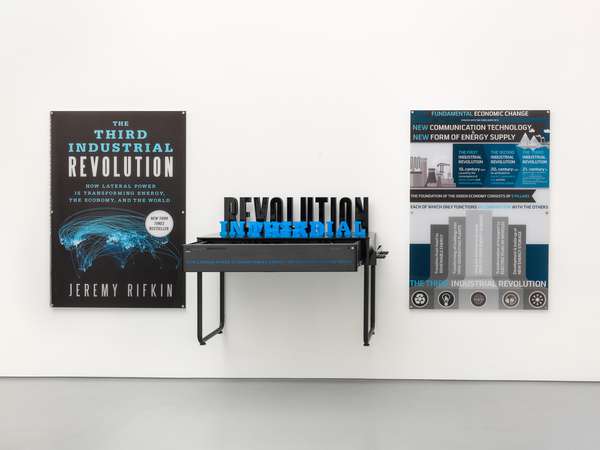











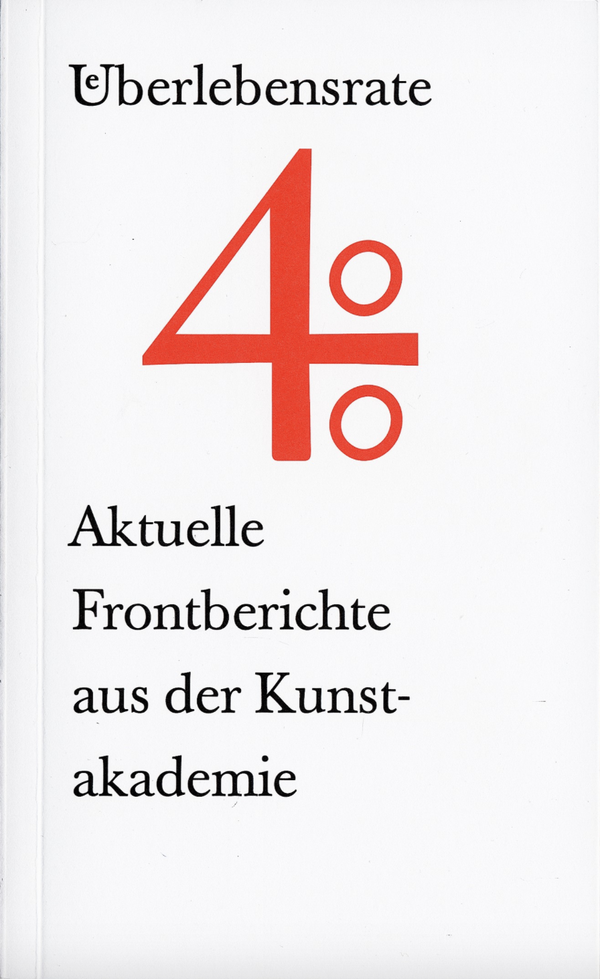


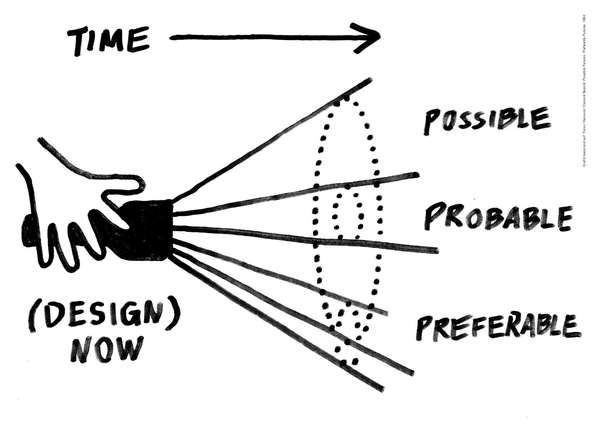
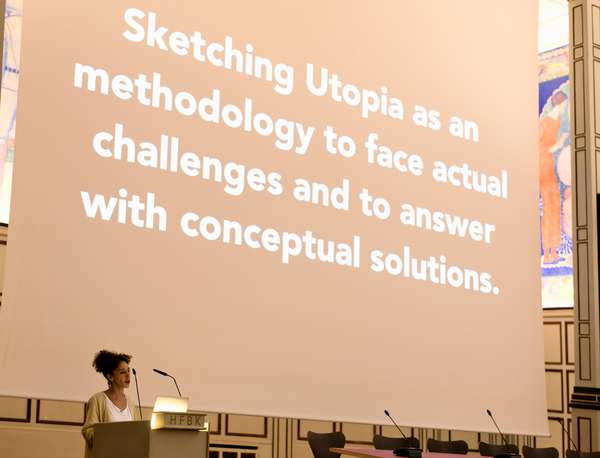
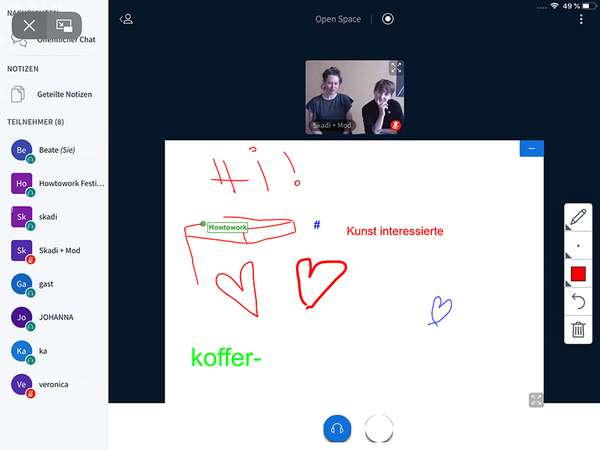

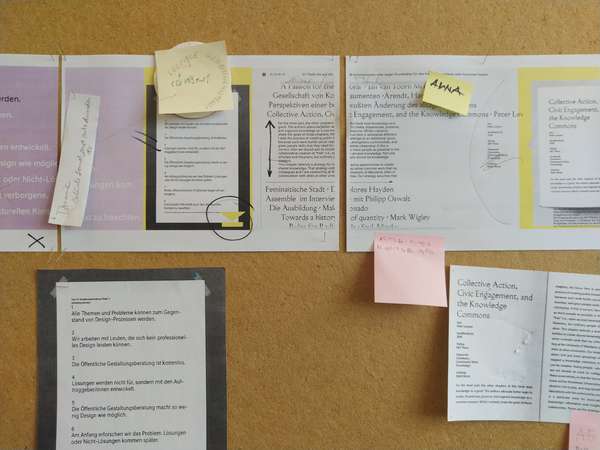
 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?