Symposiumsbericht: Überlebensrate 4%
Eine Hochschule hat ein Ziel: Junge Menschen
zu einem Studienabschluss zu führen, der ihnen erlaubt, mit dem, was sie in
diesem Studium gelernt haben, einen Beruf auszuüben, von dem sie leben können. Davon
ist auch eine Kunsthochschule zunächst nicht ausgeschlossen. Bemisst man ihren
Erfolg daran, sieht es allerdings düster aus, dieses Ziel erreichen nämlich im
Schnitt nur 4 Prozent eines Jahrgangs. Für das Symposium Überlebensrate 4% mit anschließender Podiumsdiskussion hat Werner
Büttner (Professor für Malerei/Zeichnen an der HFBK Hamburg) die Professorinnen
Annette
Tietenberg und Bettina Uppenkamp sowie die Theoretiker Walter Grasskamp, Wolfgang Ullrich und
Diedrich Diederichsen eingeladen.
Vier Prozent – eine so dramatische Zahl
verlangt nach Relativierung. Denn diese Überlebensrate betrifft tatsächlich nur
die Absolvent*innen des Studiengangs Freie Kunst, also nur ein Drittel der
Absolvent*innen von Kunsthochschulen insgesamt. In den Design-, Architektur-
und Pädagogikstudiengängen sieht es besser aus: 30 bis 80 Prozent der Absolvent*innen
verdienen später ihr Geld in diesen Bereichen. Ein Grund unter vielen, so Walter
Grasskamp, sich gegen den Branchenrassismus der Königsdisziplin gegenüber diesen
Studiengängen stark zu machen. Dass sich die Kunstgewerbeschulen alle nach und
nach in der Pflicht sahen, den Studiengang Freie Kunst einzurichten sei
eigentlich vergleichbar mit der Idee, im Sportstudium die Disziplin „Olympiade
und Weltmeisterschaften“ einzuführen (in der Kunst müsste es bloß „Preise und
Biennalen“ heißen). Dennoch ist die Zahl ein Anlass zu Selbstkritik. Grasskamp
macht die „pseudofamiliäre Psychostruktur“ von Kunsthochschulen und vor allem
den Klassenverbund dafür verantwortlich, „Nestphänomene“ zu verursachen. Die
Meisterklassen haben ihre historische Funktion längst verloren und bringen bloß
den Professor*innen einen schmeichelhaften Status ein.
In eine
ähnliche Richtung geht Annette Tietenberg. Einen falschen Stolz dürfe es in der
Freien Kunst nicht geben. Wenn junge Künstler*innen von Residencies, Preisen
und Stipendien leben, dann muss eben auch gelehrt werden, wie man erfolgreiche
Bewerbungen schreibt. Sie schlägt in ihrem Vortrag außerdem vor, Leben und
Überleben zu unterscheiden. Absolvent*innen von Kunsthochschulen geht es eben
nicht nur ums „Überleben“, sondern auch ums „Leben“ – freischaffende Künstler*innen
sind, unabhängig davon, ob sie mit ihrer Kunst oder mit etwas anderem Geld
verdienen, „Konstrukteure neuer Lebenssituationen“. Das freilich hinterlässt
bei den Zuhörer*innen den Eindruck, dass Verklärung der Künstlerfigur und damit
einhergehender Künstlerstolz hier quasi durch die Hintertür wieder hereingeschlüpft
kommen: Der Künstler als Lebenskünstler, als Gralshüter des Savoir-vivre auch
in der neoliberalen Gegenwart. Dass sich Kunsthochschulen heute (oder doch
schon immer?) in einem Spannungsfeld zwischen freier künstlerischer Entfaltung
und Einbindung in politisch-ökonomische Systeme befinden, veranlasst die
Kunsthistorikerin Bettina Uppenkamp zu der Überlegung, ob Kunstakademien ein „Refugium“
sind, sein können und sein sollten. Wird häufig verlangt, dass die Hochschule die
regionale Entwicklung der Kreativwirtschaft unterstützt, so dient sie
Studierenden doch oft dazu, nicht nur in künstlerischer, sondern auch in
politischer Hinsicht die eigene Position zu schärfen – beispielsweise gegen die
Pegida-Demonstrationen in Dresden, wo Uppenkamp bis zu ihrem Wechsel an die
HFBK Hamburg als Professorin tätig war. Diedrich Diederichsen stellt die Frage
anders, nämlich so, dass dabei eine marxistisch informierte Arbeitswerttheorie
der Bildenden Kunst herauskommt. Wenn nur 4 Prozent der ausgebildeten Künstler*innen
finanziell erfolgreich sind, müsste man doch zunächst einmal fragen, wie es
dazu kommt. Wird vielleicht zu viel Kunst produziert? Verfällt der Preis von
Kunst deshalb, wie beim Öl? Oder sorgt eine bestimmte Aufmerksamkeitsökonomie dafür,
dass wenige viel und viele kaum etwas verdienen, dass also einige wenige
Künstler*innen den Weg versperren für die anderen? Wohl kaum.
Mit Kant
gesprochen, ist die Subjektivität eine Quelle von Allgemeinheit, ein Zuviel an
Kunst kann es nicht geben. Und außerdem ist Kunst nicht nur Kunst, ein Bild ist
nicht nur ein Bild, sondern in ihm sind Kenntnisse und Fähigkeiten gebunden,
Wissen aus einem ganzen Kunststudium. Erst, wenn man künstlerische Arbeit
arbeitswerttheoretisch denkt, lassen sich politische Forderungen formulieren, die
den Wert künstlerischer Arbeit nicht allein dem Markt überlassen. Es ließe sich
gewerkschaftliche Organisation von Kunstschaffenden denken – oder ein
Mindestlohn für die 96 Prozent.
Auch Wolfgang Ullrich stellt in seinem Vortrag eine
Grundsatzfrage, die nach Veröffentlichung des Vortrags im Internet einige
Wellen schlug. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich nämlich der Begriff des
„erfolgreichen Künstlers“ als zweideutig – weil es zwei verschiedene
Auffassungen von Kunst gibt. Ein Schisma tut sich auf, meint Ullrich, zwischen
der „Kunstmarkt-Kunst“ auf der einen Seite, die für immer höhere Preise
gehandelt und als Investment gekauft wird, und der Kunst des politischen
Engagements auf der anderen Seite. Ob man in die eine oder die andere Richtung
blickt, in beiden Fällen verliert die Kunst an Autonomie und wird stattdessen
an gesellschaftliche Funktionen gebunden – Geld und Politik. Anders gesagt: Künstlerinnen und Künstler,
deren Arbeiten auf der Autonomie der Kunst basieren, sich also die Kunstgeschichte
und Wahrnehmung selbst zum Gegenstand ernennen, haben es zunehmend schwer. Die
Kunsthochschulen könnten in Zukunft ein besonderer Schauplatz dieser Spaltung sein.
Mehr noch als andere Institutionen stehen sie untereinander im Wettbewerb,
unter dessen Druck sie ein möglichst markantes Profil auszubilden versuchen.
Und nirgendwo steht festgeschrieben, dass eine Kunsthochschule für immer ihre Kandidaten ungeachtet ihrer Kunstausrichtung auszuwählen habe, wie es heute noch der Fall ist: Wenn man sagt, man wolle mit der Kunst reich und berühmt werden, so kann man damit genauso gut einen Studienplatz bekommen, wie wenn man sich mit der Begründung bewirbt, man sei gegen den Kapitalismus und strebe an, mit den Mitteln der Kunst die Gesellschaft zu verändern. Dass die fünf Vorträge zur Causa 4% in solch unterschiedliche Richtungen gehen, erscheint selbst fast wie eine Lektion zum Thema: Will man über die künstlerische Tätigkeit als Arbeit sprechen, kommt man nicht umhin, die Struktur von Arbeit als solche und die Entwicklung der Kunst insgesamt in den Blick zu nehmen – und die Frage, wie und was an Kunsthochschulen gelehrt werden soll. (Birthe Mühlhoff)

 Symposium: Überlebensrate 4%
Symposium: Überlebensrate 4%













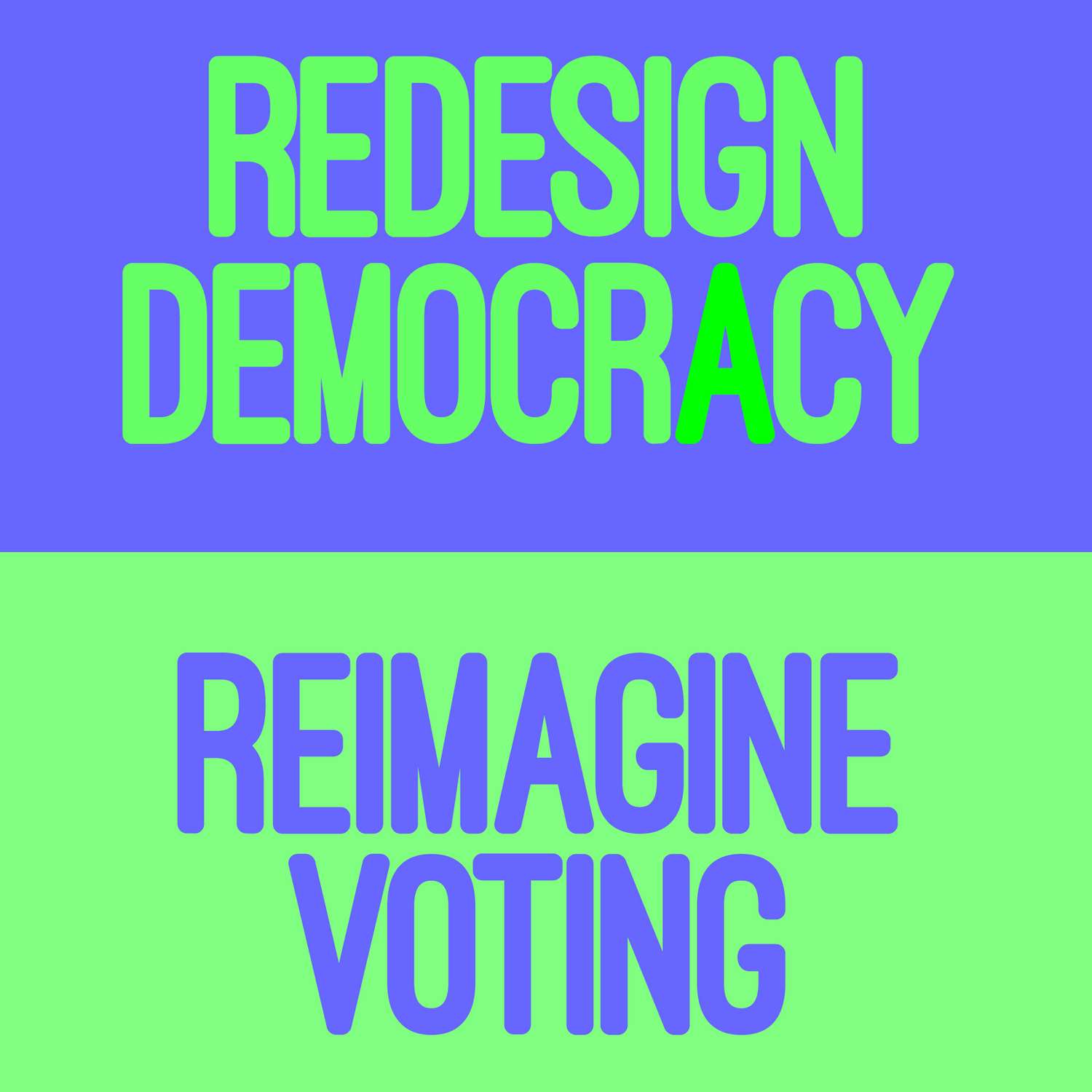























































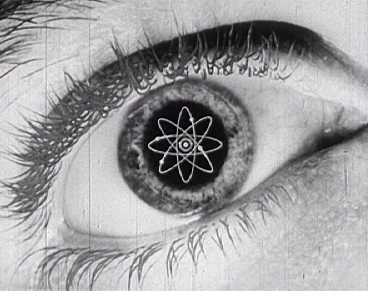
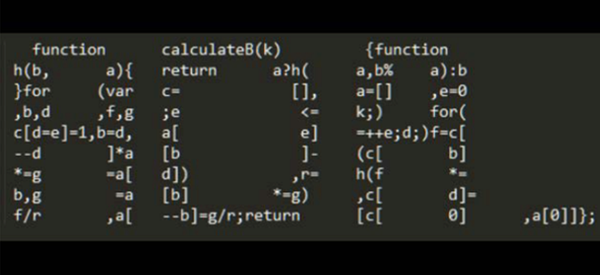
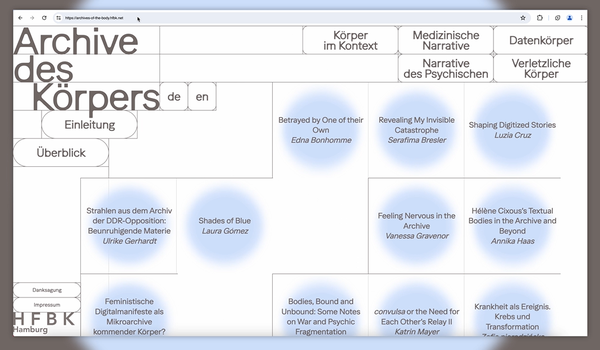













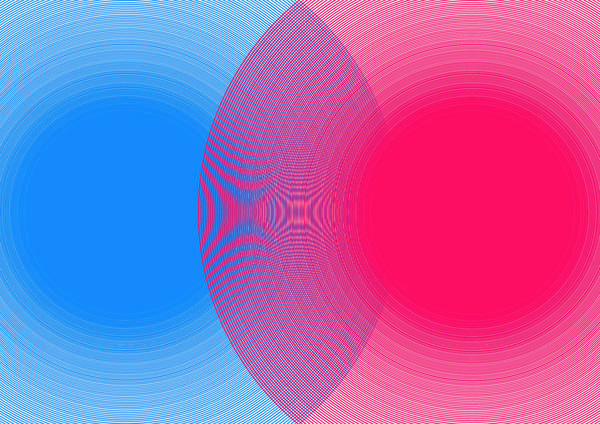










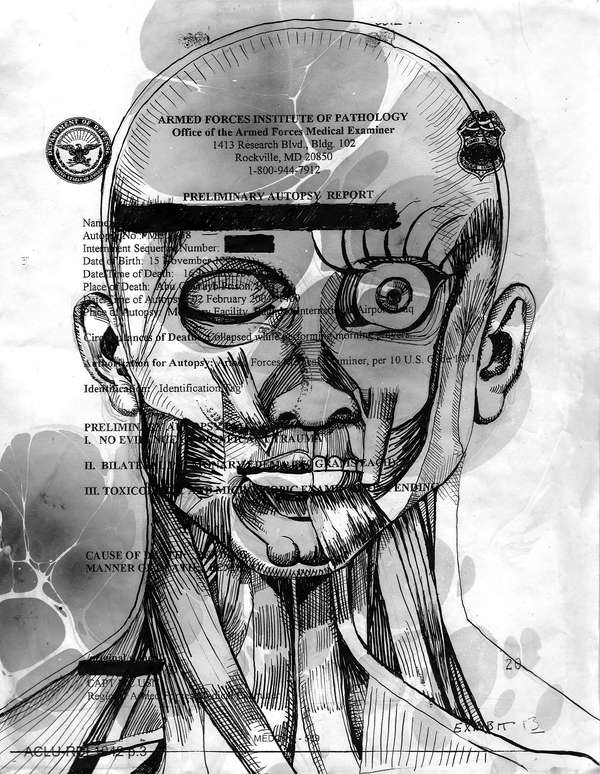



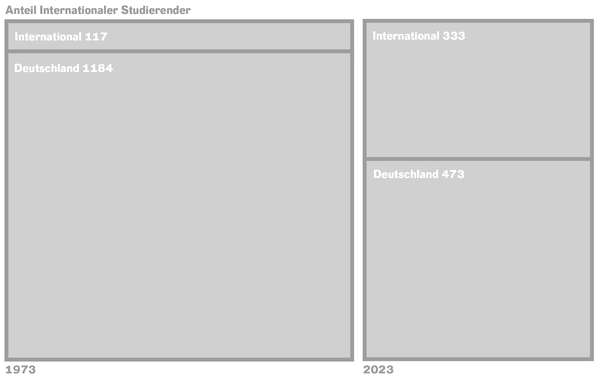
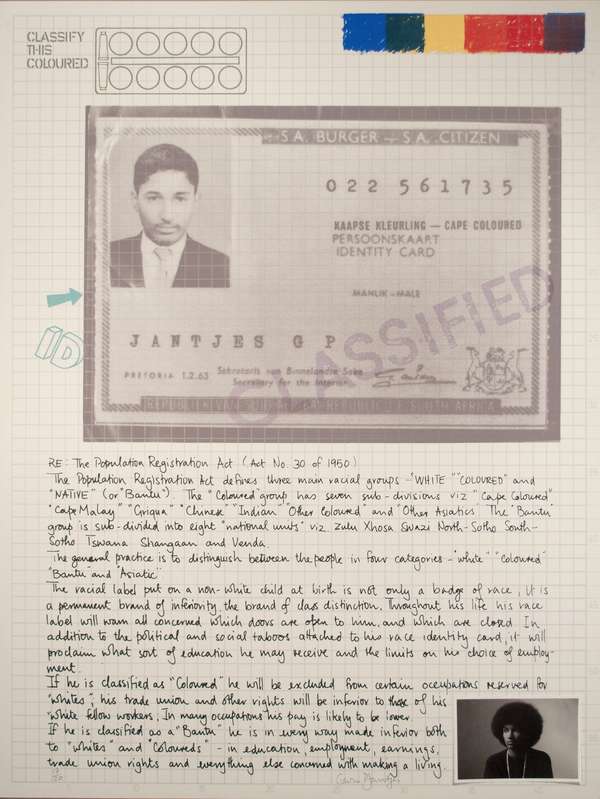
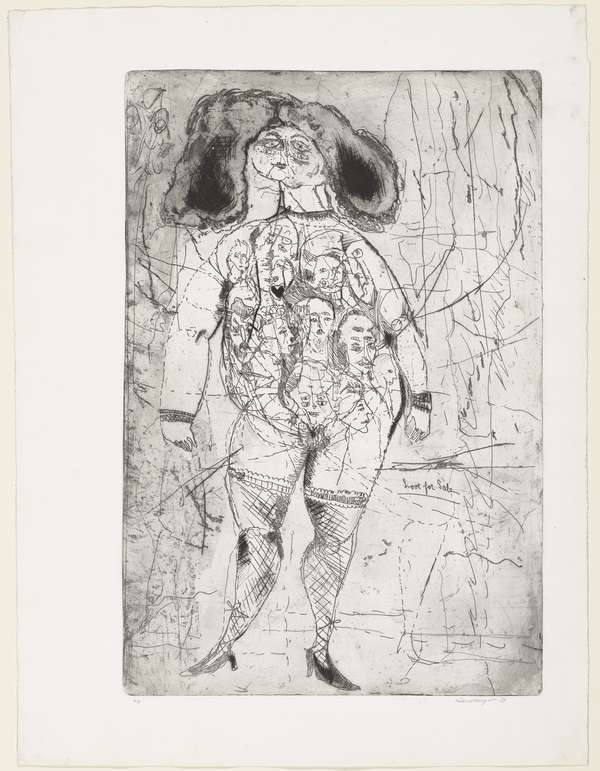






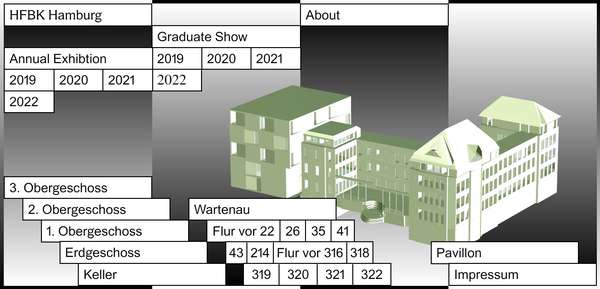








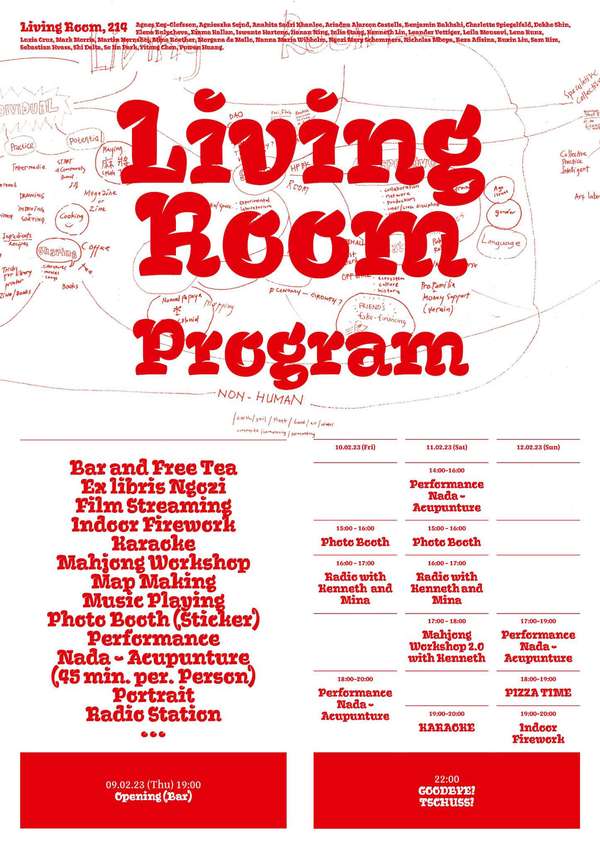





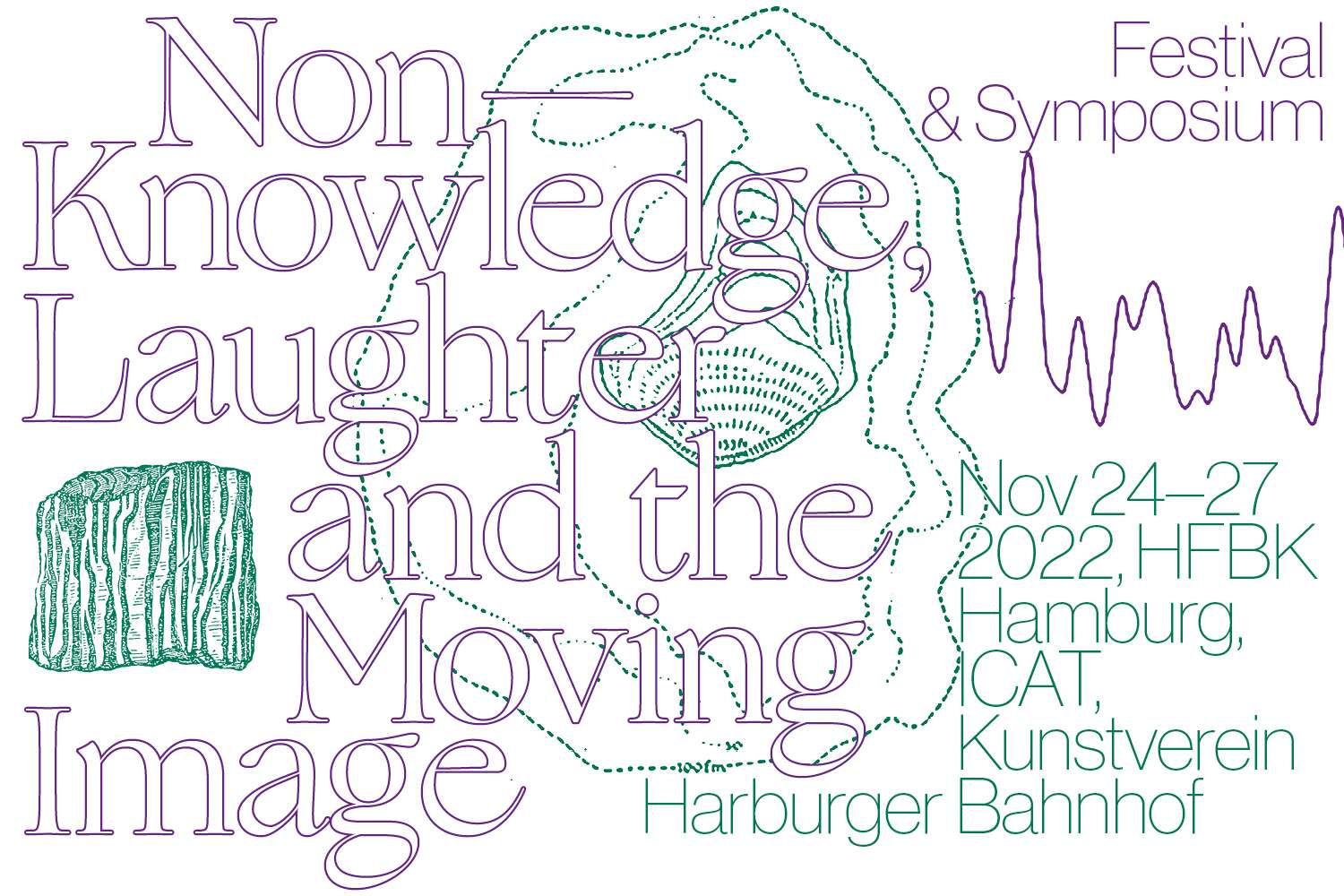















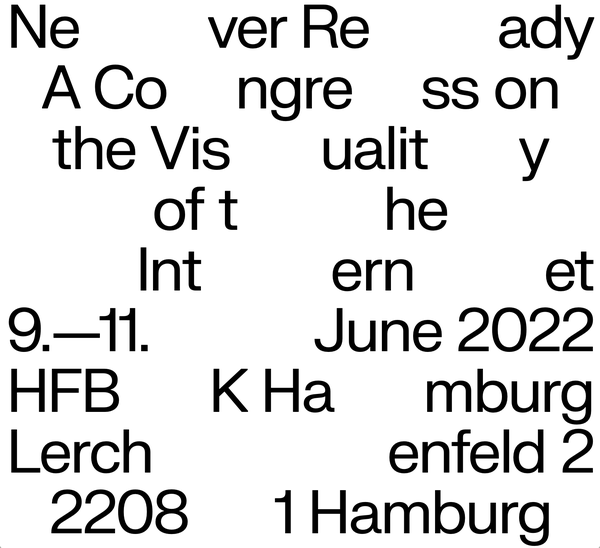






















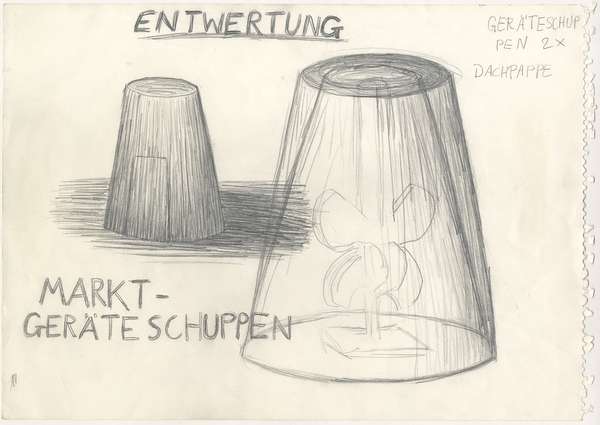
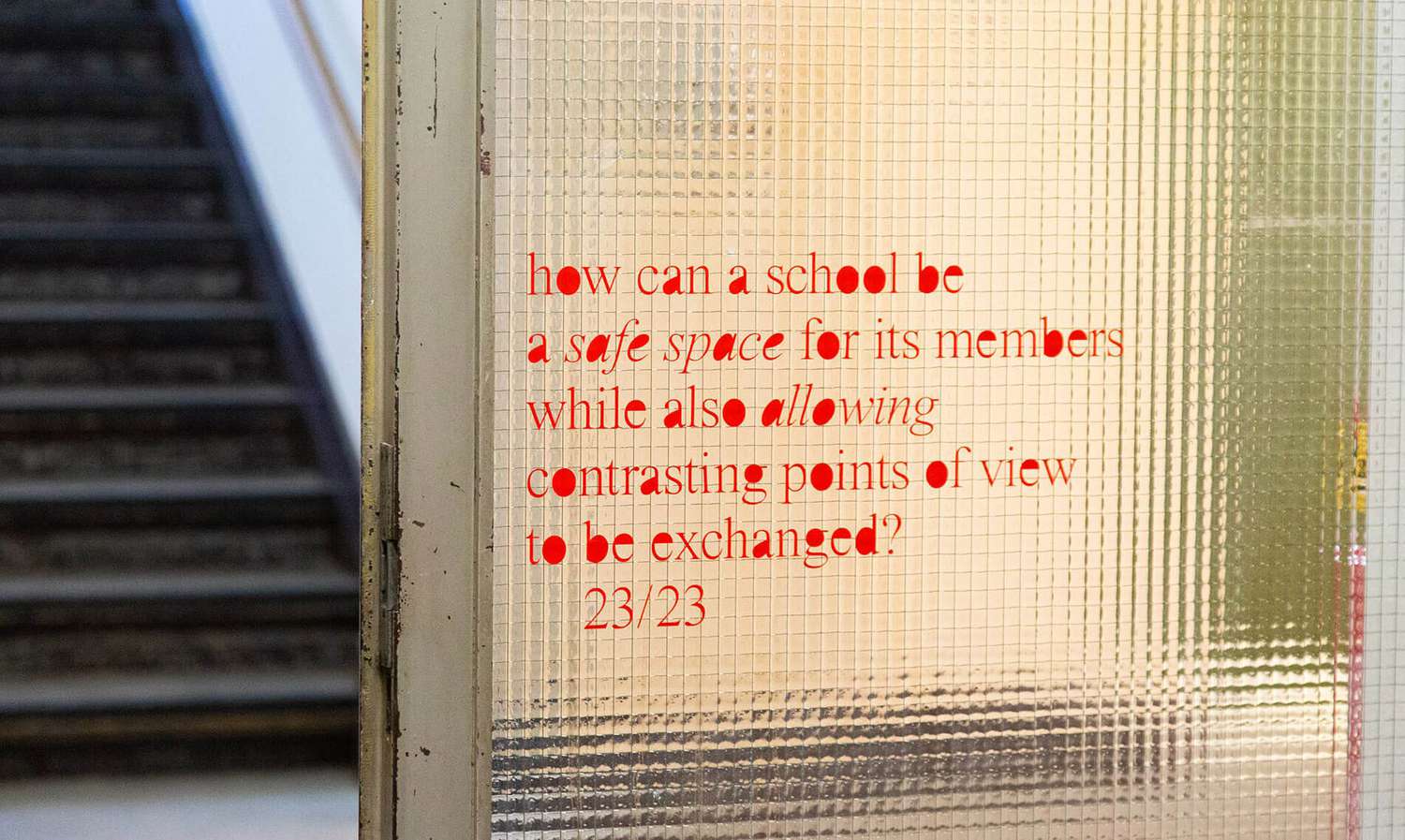


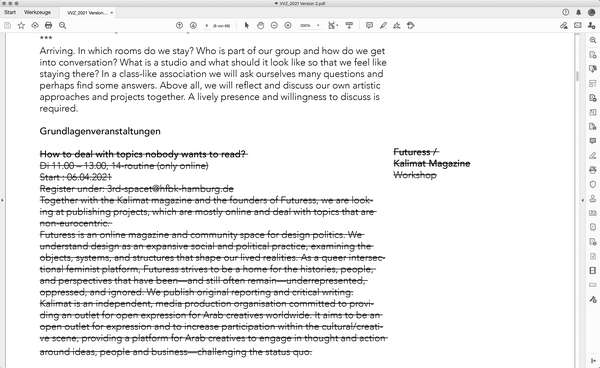






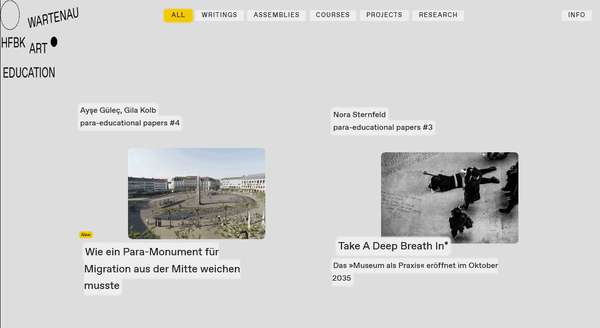


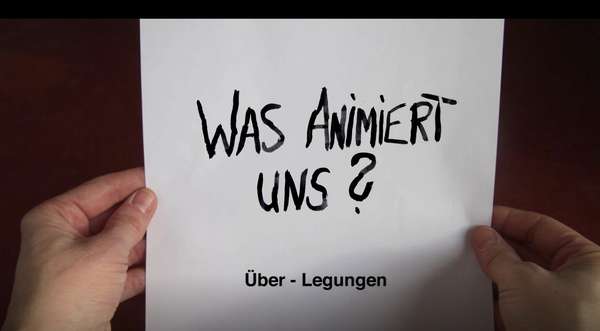





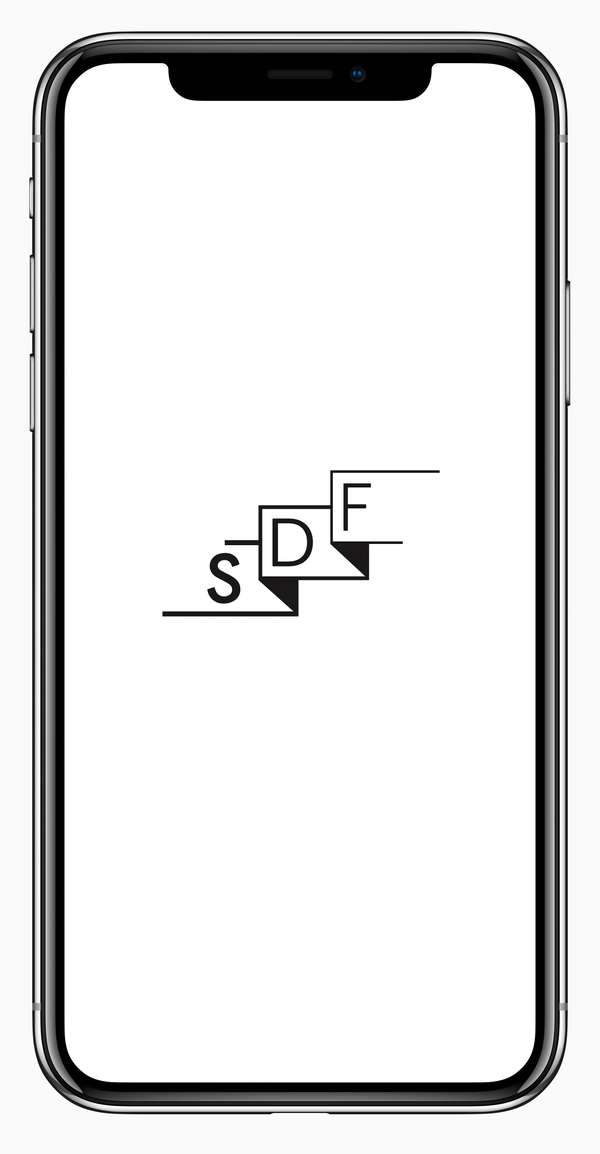
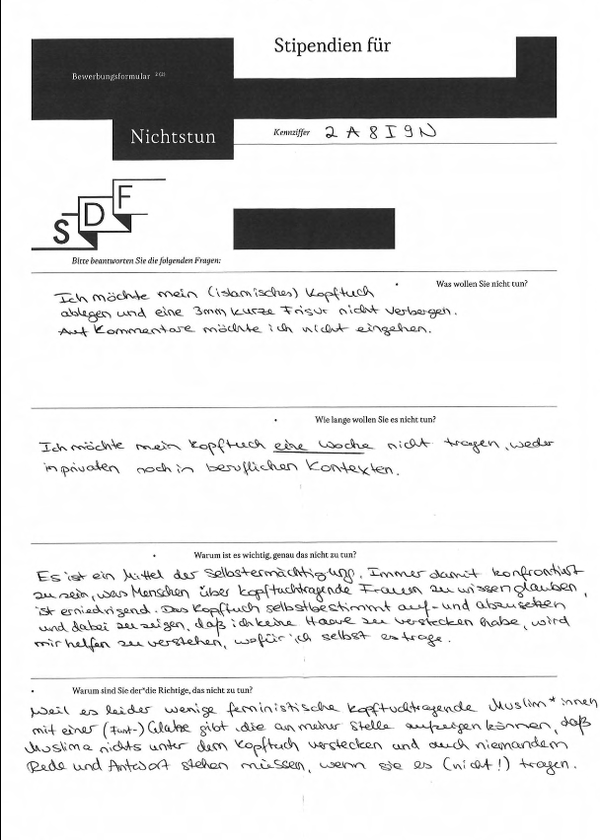




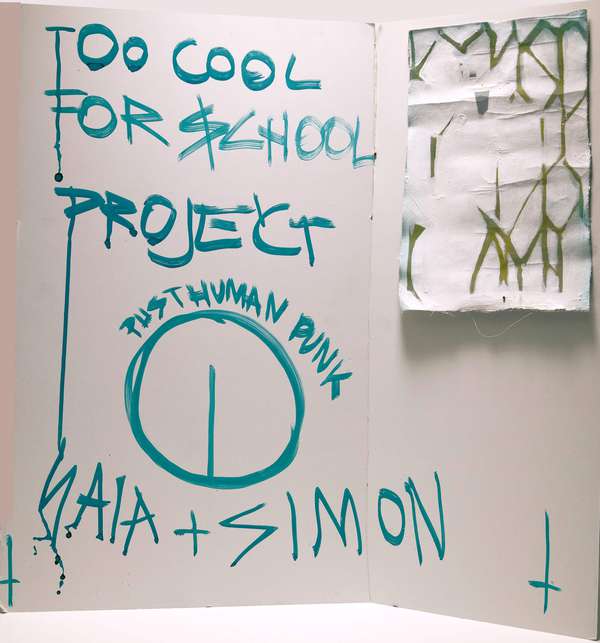

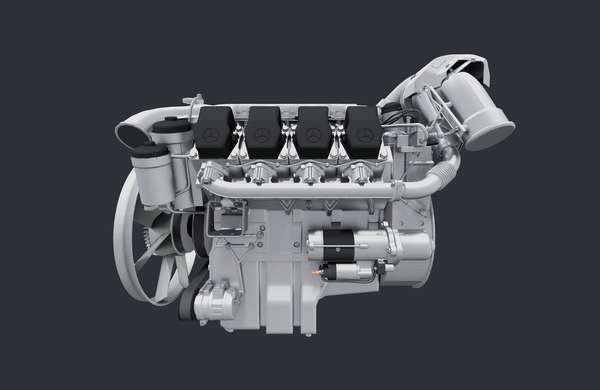





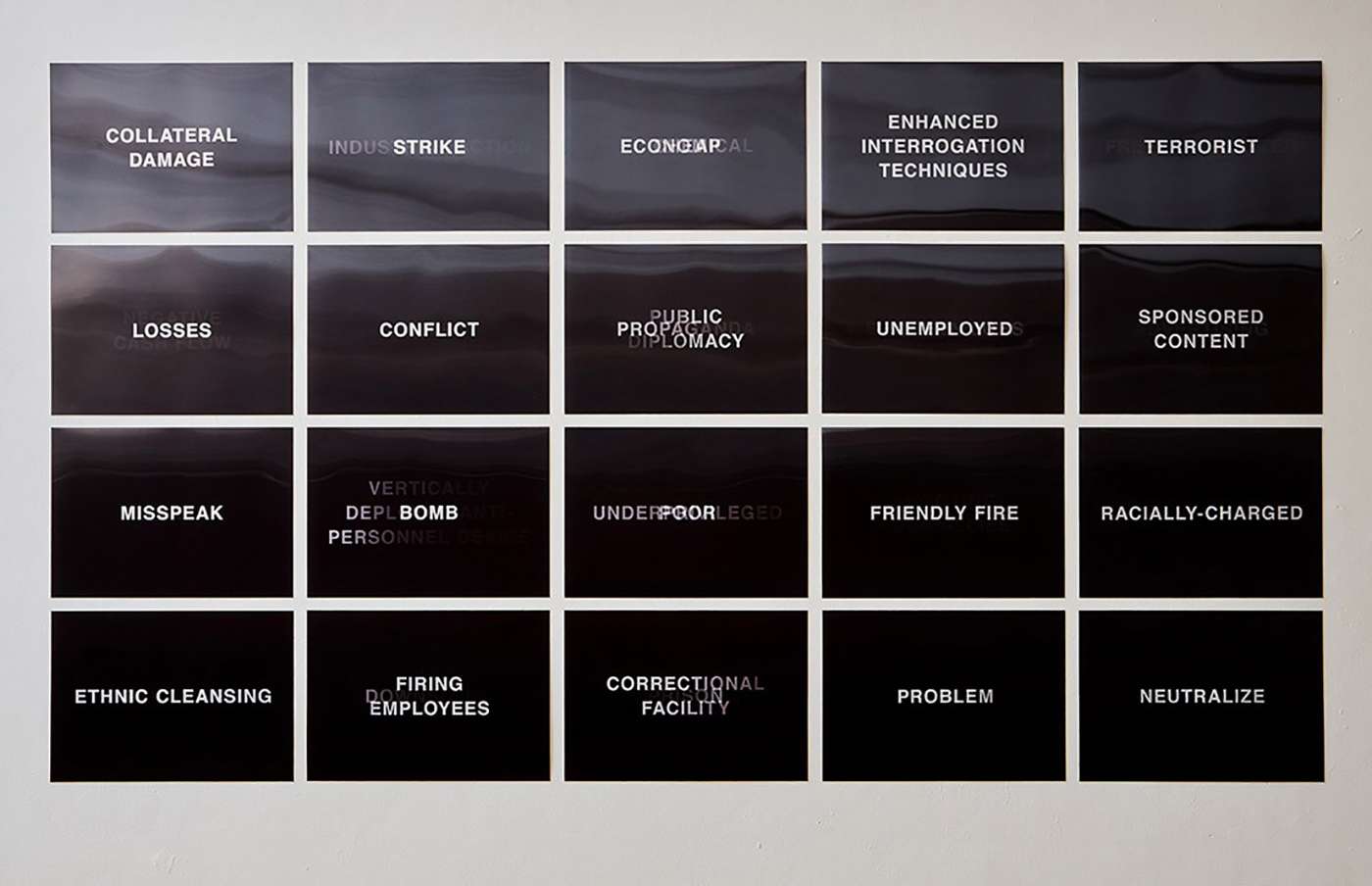




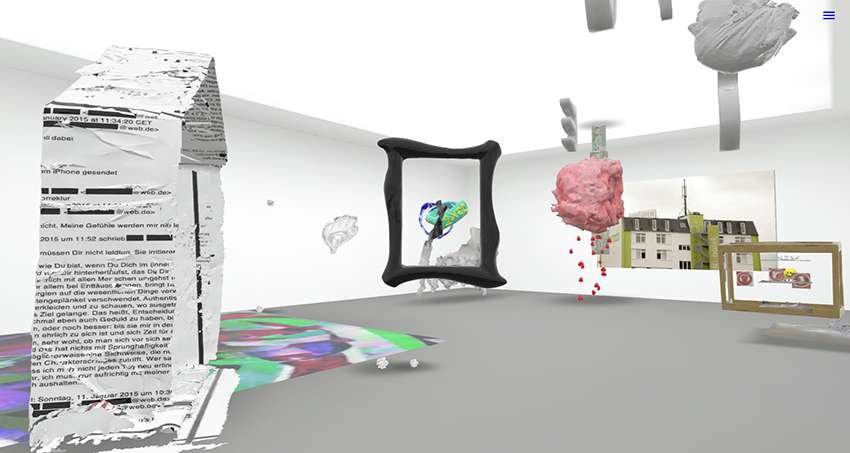
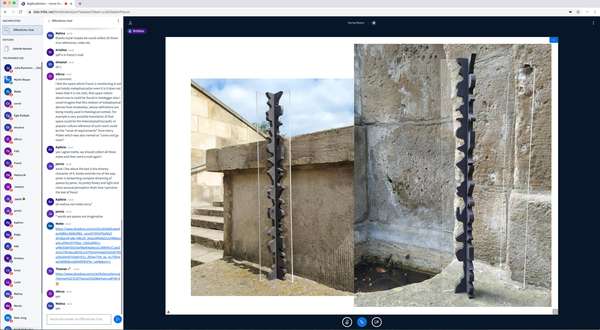
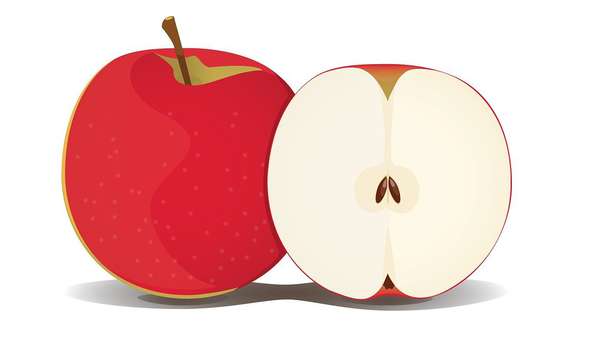

















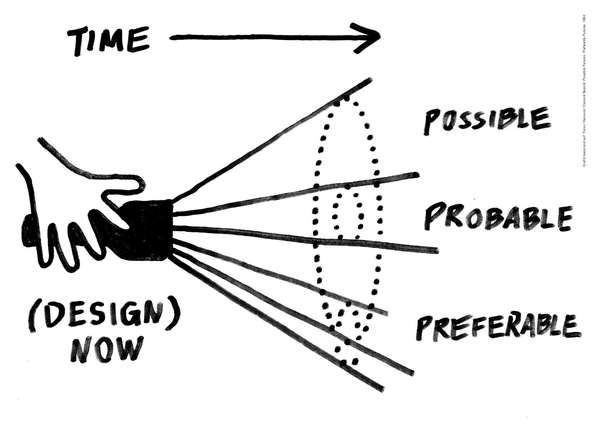

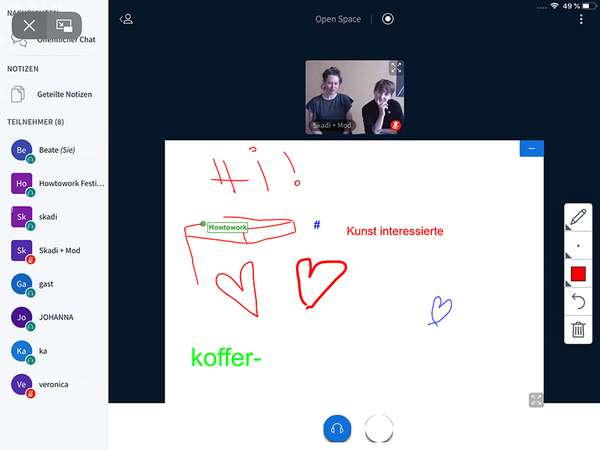

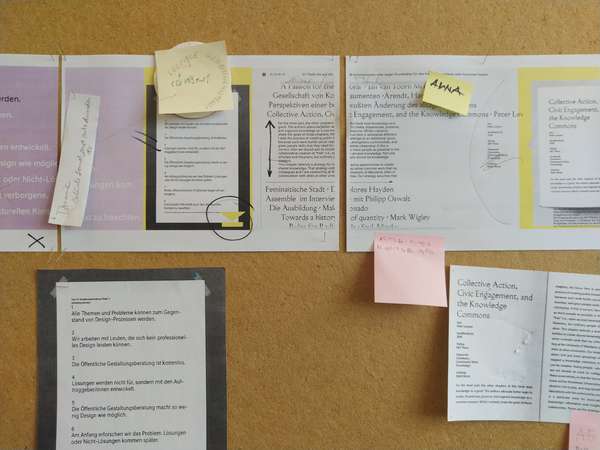
 Graduate Show 2025: Don't stop me now
Graduate Show 2025: Don't stop me now
 Lange Tage, viel Programm
Lange Tage, viel Programm
 Cine*Ami*es
Cine*Ami*es
 Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft
 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum
 How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
How to apply: Studium an der HFBK Hamburg
 Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg
 Der Elefant im Raum – Skulptur heute
Der Elefant im Raum – Skulptur heute
 Hiscox Kunstpreis 2024
Hiscox Kunstpreis 2024
 Die Neue Frau
Die Neue Frau
 Promovieren an der HFBK Hamburg
Promovieren an der HFBK Hamburg
 Graduate Show 2024 - Letting Go
Graduate Show 2024 - Letting Go
 Finkenwerder Kunstpreis 2024
Finkenwerder Kunstpreis 2024
 Archives of the Body - The Body in Archiving
Archives of the Body - The Body in Archiving
 Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa
 Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg
 (Ex)Changes of / in Art
(Ex)Changes of / in Art
 Extended Libraries
Extended Libraries
 And Still I Rise
And Still I Rise
 Let's talk about language
Let's talk about language
 Graduate Show 2023: Unfinished Business
Graduate Show 2023: Unfinished Business
 Let`s work together
Let`s work together
 Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg
 Symposium: Kontroverse documenta fifteen
Symposium: Kontroverse documenta fifteen
 Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image
 Einzelausstellung von Konstantin Grcic
Einzelausstellung von Konstantin Grcic
 Kunst und Krieg
Kunst und Krieg
 Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun
 Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
Der Juni lockt mit Kunst und Theorie
 Finkenwerder Kunstpreis 2022
Finkenwerder Kunstpreis 2022
 Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule
 Raum für die Kunst
Raum für die Kunst
 Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg
 Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments
 Diversity
Diversity
 Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021
 Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen
 Schule der Folgenlosigkeit
Schule der Folgenlosigkeit
 Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg
 Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020
 Digitale Lehre an der HFBK
Digitale Lehre an der HFBK
 Absolvent*innenstudie der HFBK
Absolvent*innenstudie der HFBK
 Wie politisch ist Social Design?
Wie politisch ist Social Design?